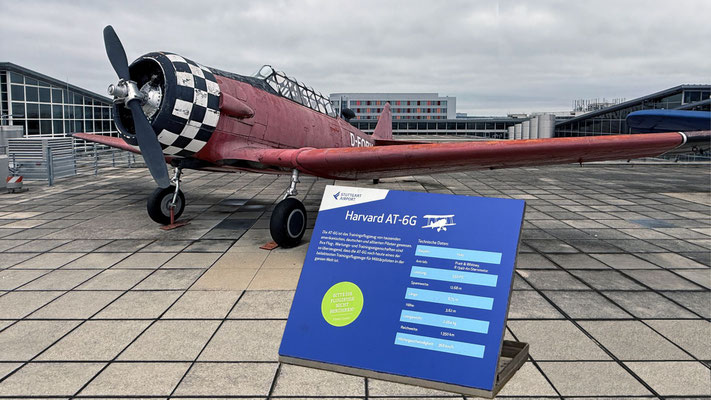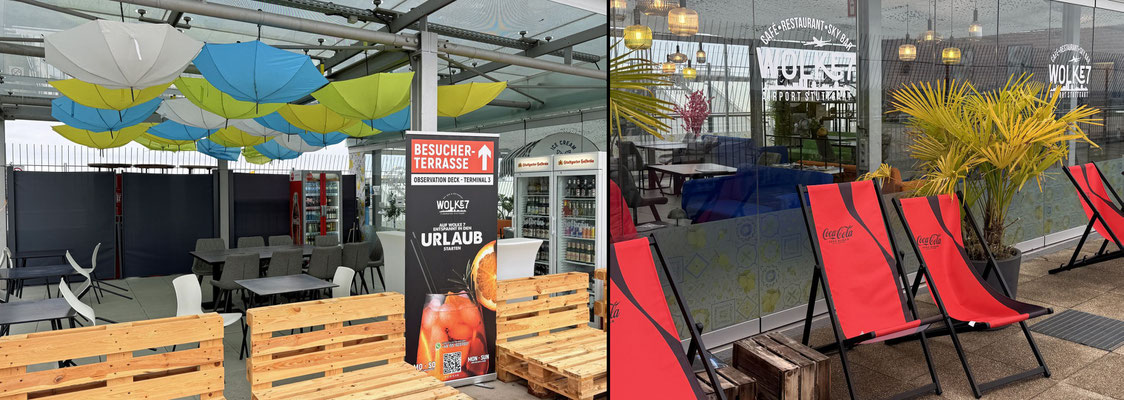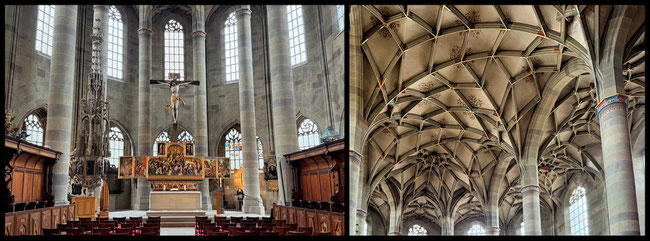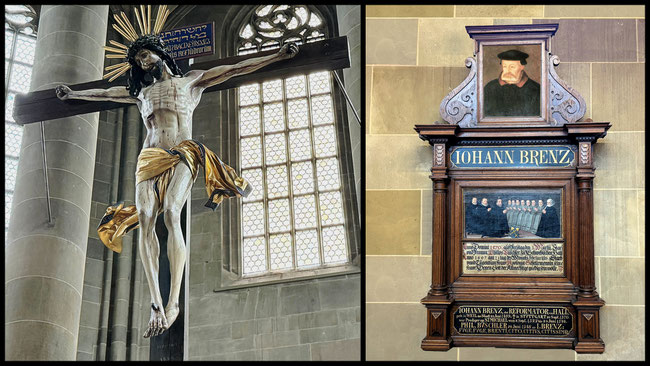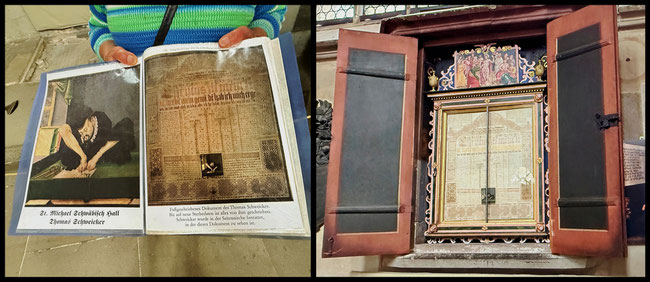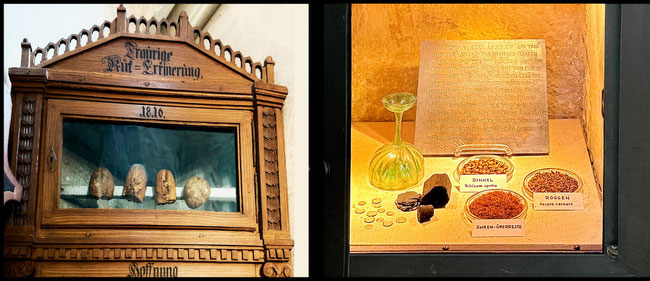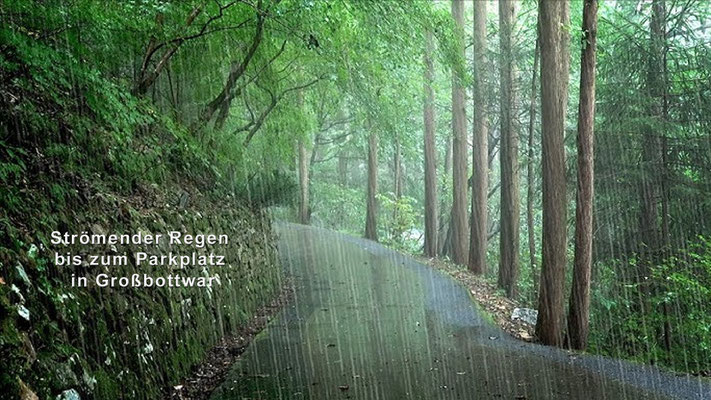„Wer nicht mitfliegt, geht wenigstens auf eine kleine Entdeckungstour.“
Nun, um es gleich vorweg zu sagen: wir blieben am Boden, doch unsere Stimmung, die hob ab. Wir, das waren 58 Aktive Sparkassen Pensionäre, die sich am Dienstag, 23.09.2025, um 09:45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg trafen. So eine große Gruppe sorgt schon etwas fü Aufsehen. Ob deshalb eine Polizeistreife langsam vorbeifuhr? Aber die Ordnungshüter haben sicher gleich bemerkt, so herzlich, wie sich die Anwesenden begrüßten und umarmten, strahlten und lachten, das muss eine nette Truppe sein. Und so nickte auch der Fahrer des Autos freundlich und lächelnd zu uns herüber.

Ebenfalls lächelnd begrüßte uns Friedrich Rutte, auch im Namen von Monika Lang, sehr herzlich zu der anschließend vorgesehenen Flughafenführung. Die beiden Organisatoren dieser heutigen ASP-Veranstaltung betonten ihre Freude über die große und positive Resonanz. Dann gab uns Friedrich Rutte einen kurzen Überblick über den Verlauf des heutigen Tages. Seine Frage, ob wir auch alle unsere Badesachen dabeihaben, ließ uns natürlich kurz stutzen. Die folgende Erklärung, dass Monika Lang und er ja nicht nur für gutes Wetter gesorgt, sondern für uns auch einen Hin- und Rückflug nach Mallorca mit kurzem Strandaufenthalt gebucht hätten, führte dann natürlich zu einem größeren Lacherfolg.

So positiv eingestimmt ging es dann auf den Bahnsteig, um mit der S-Bahn nach Stuttgart-Hauptbahnhof zu fahren. Von dort war es noch ein kurzer Fußweg zum Schlossplatz und zu unserem ersten Ziel: Carls Brauhaus. Hier war für uns ab 11:00 Uhr reserviert und wir nahmen rasch unsere Plätze ein. Schnell entwickelte sich an allen Tischen eine rege Unterhaltung, und es war deutlich zu spüren, dass es zwischen den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen noch immer eine herzliche Verbindung gibt. „Weisch no, domols…“ und auch „Ond, was hosch denn d’letschd Zeit so g’macht?“ Das waren dabei die häufigsten Fragen, und so gab es denn ja auch sehr viel zu erzählen. Wie immer, waren auch diesmal Service und Essen in Carls Brauhaus gut.
Und so ging es anschließend von dort weiter zur U-Bahn-Station, um von hier mit der U 6 bis zum Flughafen Stuttgart zu fahren.
Es sei noch angemerkt, dass wir, sobald wir uns im Freien befanden, alle immer unseren Schirm suchten. Nein, nicht den, den wir in unseren Handtaschen oder Rucksäckchen verstaut hatten und glücklicherweise nicht benötigten, sondern den bunten Schirm, den Friedrich Rutte – als unser selbst ernannter „Schirmherr“ - immer in die Höhe hielt, damit wir wussten, in welche Richtung wir ihm folgen müssen.
Nach ca. einer halben Stunde waren wir am Flughafen angekommen. Hier war Terminal 3 unser Ziel, denn da sollten sich um 14.:30 Uhr unsere beiden Führer bei uns melden. Bis dahin war jedoch noch etwas Zeit. Doch wie heißt es so nett: „Am Flughafen ist Geduld das beste Handgepäck!“ Was uns gleich zu Beginn auffiel war, dass es heute ziemlich ruhig zuging und sich nicht sehr viele Fluggäste hier bewegten, wodurch eine entspannte Atmosphäre herrschte. Für uns hatte dies den Vorteil, dass wir uns in aller Ruhe etwas umsehen und einen ersten Eindruck gewinnen konnten. Das Ambiente von Terminal 3 ist durch Transparenz, Offenheit und viel Tageslicht geprägt. Eine raffinierte Lichtführung, die weiten Hallen und die Integration von Pflanzen sorgen spürbar für eine entspannte und angenehme Aufenthaltsqualität. Was auch manche von uns einlud, einfach mal für einige Zeit in Ruhe Platz zu nehmen und den ersten Eindruck auf sich wirken zu lassen. Ins Auge fällt einem die Dachkonstruktion mit ihrem sog. „abgetreppten Pultdach“, welche das Dach optisch in mehreren Ebenen versetzt erscheinen lässt und somit auch gewährleistet, dass viel Tageslicht durch die großen Oberlichter einfällt. Dabei wird dieses Pultdach von 18 filigranen Stahlstützen getragen, die an Baumstämme erinnern und dem Gebäude somit eine leichte und transparente Wirkung verleihen.
Einige unter uns nutzen die Zeit bis zur Führung, um sich auf die Besucherterrasse zu begeben. Diese bietet einen eindrucksvollen Ausblick auf das Vorfeld, wo wir Starts und auch Landungen ebenso beobachten können, wie das Andocken an die Fluggastbrücken oder das Betanken, Be- oder Entladen der Flugzeuge. Das verstärkt natürlich unsere Neugier und Erwartung auf die anstehende Führung, bei der wir ja das Flugfeld auch direkt betreten werden. Aber nicht nur der Blick nach unten ist hier interessant, sondern auch der Blick auf die hier oben abgestellten „Oldies“ der Luftfahrt. Ins Auge fällt einem dabei sofort die blaue „Antonow An-2“, die 1947 ihren Erstflug hatte. Die An-2 ist der größte einmotorige Doppeldecker, der mit seinen großen Tragflächen für ausgezeichnete Flugeigenschaften sorgte. Doch genauso sehenswert ist das daneben abgestellte rote Flugzeug, eine „Harvard AT-6G“. Sie diente vor allem als Schul- und Trainingsflugzeug für Piloten der US Air Force, der Royal Air Force und vieler weiterer Luftstreitkräfte.
Jetzt war es aber an der Zeit, die Besucherterrasse wieder zu verlassen. Dies jedoch nicht, ohne noch einen kurzen Blick auf „Wolke 7“ zu werfen, dem harmonischen Zusammenspiel von moderner Gastronomie und Flughafen-Feeling. Das mediterrane und zypriotische kulinarische Angebot lädt dazu ein, dies bei einem eventuell späteren Besuch doch einmal zu genießen.
Inzwischen trafen auch die beiden Führer, die Herren Frank Dizinger und Heinz Krehl, ein und stellten sich uns kurz vor. Für uns hieß es nun: „Hier am Flughafen starten täglich viele Flüge – und jetzt auch unsere Führung.“ Das Aufteilen in zwei Gruppen verlief sehr zügig. Ich selbst gehörte der Gruppe mit Herrn Dizinger an. Dieser vermittelte uns nun den Alltag am Flughafen Stuttgart aus spannenden, teils exklusiven Blickwinkeln. Wir wurden gleich darauf hingewiesen, dass bei der Führung bestimmte Gegenstände nicht mitgeführt werden dürfen. Und wir bekommen gesagt, dass wir im weiteren Verlauf und insbesondere bei der Sicherheitskontrolle wie normale Passagiere behandelt würden. Apropos Passagiere: wie uns gesagt wird, rechnet der Flughafen für das laufende Jahr mit etwa 9,6 Millionen Passagieren. So sind allein in den Sommerferien über 1,6 Millionen Fluggäste am Flughafen Stuttgart gestartet oder gelandet. Wobei der 12. September dieses Jahres mit 285 Starts und Landungen der Tag mit den meisten Flugbewegungen der vergangenen fünf Jahre war. Für viele von uns sind dies doch sehr beeindruckende Zahlen. Die beliebtesten Flugziele waren dabei vor allem die klassischen Urlaubsländer wie die Türkei, Spanien und Griechenland.
Auf den Hinweis aus unserer Gruppe, dass wir das Gefühl hätten, dass es im Moment aber doch sehr ruhig zuging, meinte Herr Dizinger, dass dies an der Uhrzeit liege. Der Hauptbetrieb findet morgens und abends statt. Dann ging es um die Begriffe Direktflug und Nonstopflug, weil diese sehr gerne verwechselt würden. So ist kurzgesagt zwar jeder Nonstopflug ein Direktflug, aber nicht jeder Direktflug ein Nonstopflug. Für uns ging es nun „Nonstop“ weiter zur Ausgabe von orangefarbenen Warnwesten, die uns als Besucher auswiesen.
Wir erfahren noch, dass am Flughafen Stuttgart Flugzeuge grundsätzlich nur zwischen 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr starten, bzw. bis 23:30 Uhr landen dürfen, von festgelegten Ausnahmen abgesehen, wie z.B. Notfälle, Polizei- und Katastrophenschutz oder medizinisch erforderliche Flüge. Ansonsten besteht ein Nachtflugverbot.
Dann gehen wir weiter in Richtung Terminal 4. Dies ist das älteste Gebäude aus dem Jahr 1955 und war früher ein Flugzeug-Hangar, der etwa 1999-2000 erst zum Terminal umgebaut wurde. Sobald es mit den geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten am Flughafen losgeht, soll dieses Gebäude angeblich komplett abgerissen werden. Mit den Baumaßnahmen soll ab 2027 begonnen werden. Die Gesamtinvestitionen liegen bei ca. 2,4 Milliarden Euro.
Auch wenn es Zuschüsse von Bund und Land gibt, bleibt die Frage: wo bekommt der Flughafen das viele Geld her? Wo und wie kann er das erwirtschaften? „Ganz einfach“, so die Antwort von Herrn Dizinger, „auf der Start- und Landebahn!“ Denn wenn ein Flugzeug landet, kostet das Landegebühren und Abfertigungsgebühren. Aber natürlich gibt es auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder für zur Verfügung gestellte Werbeflächen. Doch die Haupteinnahmen sind die Landegebühren. Wenn ein Flugzeug die Parkposition erreicht, wird die Zeit ab dem Moment festgehalten, wo der Bremsklotz unter das Bugrad gesetzt wird. Ab da wird minutengenau berechnet bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bremsklotz wieder entfernt wird. Auch die Busse werden berechnet. Nach Aussage von Herrn Dizinger fallen hierfür so zwischen 3.000 € und 3.500 € an. Und so ist unser Führer sehr zuversichtlich, dass auch dieses Jahr wieder „die schwarze Null“ erreicht wird.
Dann erfahren wir noch, dass es am Flughafen Stuttgart auch immer wieder Kofferversteigerungen gibt, bei denen herrenlose oder nicht abgeholte Gepäckstücke öffentlich versteigert werden, meist für einen guten Zweck und mit einem großen Unterhaltungswert. Wenn sich die Eigentümer von nicht abgeholten Gepäckstücken nicht ermitteln lassen, werden die Koffer nach einer Aufbewahrungsfrist von mind. sechs Monaten versteigert. Dabei können Bieter die Koffer nur von außen begutachten. Der Inhalt bleibt bis nach dem Zuschlag ein Geheimnis, was natürlich den Reiz dieses Events verstärkt. Die Erlöse aus diesen Versteigerungsaktionen werden für soziale Projekte in der Region gespendet, z.B. für die Fildertafel e.V. oder für den Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V. Und wir erfahren noch, dass der Gesamterlös der letzten großen Kofferversteigerung etwa 50.000 € erbracht hat. Auf die Frage wieviel Koffer denn meist zur Versteigerung kommen, erfahren wir, dass es letztes Jahr etwa 100 Koffer waren.
Und bei der Frage, wieso es so viele Koffer sind, nennt Herr Dizinger verschiedene Ursachen. Als Beispiel nennt er uns dann einen Fall, bei dem im letzten Jahr in Madeira eine Maschine startete, die zwar mit allen Passagieren besetzt war, die Koffer der Passagiere jedoch noch nicht an Bord waren. Die Ursache war ein Defekt bei der Gepäckabfertigung. Der Kapitän der Maschine hatte sich jedoch trotzdem für den Start entschieden, da er ansonsten die Landung nicht mehr pünktlich bis Mitternacht geschafft hätte.
Wir haben zwar noch unser Handgepäck, was uns bis jetzt jedoch noch fehlt, war ein Besucherausweis, der uns jetzt ausgehändigt wurde, und der uns als „VISITOR“ einer Flughafenführung am 23.09.2025 auswies. Diesen mussten wir nun in die dafür vorgesehene Lasche unserer Warnweste schieben. Denn nachher war die Sicherheitskontrolle unser nächstes Ziel. Jetzt wurden wir noch auf den Busbahnhof auf der gegenüberliegenden Seite hingewiesen. Der Busbahnhof, das sog. Stuttgart Airport Busterminal (SAB), befindet sich direkt zwischen der Flughafenstraße und Terminal 4, und ist eine moderne Reise-Drehscheibe mit besten Verbindungen an alle Verkehrsnetze. Er verbindet das internationale und nationale Fernbusnetz mit dem Flugverkehr. Er wird nach Aussage unseres Führers im Jahr von ca. 1 Million Fahrgästen genutzt.
Nun erhalten wir noch einige Informationen bezüglich der Sicherheitskontrolle. So bekommen wir den Rat, neben den Warnwesten, unseren Jacken und Taschen, auch Geldbeutel oder Schlüsselbund in die blaue Wanne zu legen. Und Herr Dizinger empfiehlt, auch die Armbanduhren und unsere Handys mit in die blaue Wanne zu legen. Denn je mehr wir ablegen würden, um so schneller kämen wir durch die Kontrolle. Außerdem gibt er uns die Empfehlung, sofern wir künftig fliegen würden, im Vorfeld für die Sicherheitskontrolle ein Zeitfenster zu buchen, um längere Wartezeiten an der Kontrolle zu vermeiden. Wie es sich zeigt, ist dies vielen aus der Gruppe auch bekannt. Und kennen Sie auch dieses Sprichwort: „Sicherheit geht vor – doch Humor kommt immer durch die Kontrolle!“
Dann war es soweit, und wir standen am Band mit den blauen Wannen. Jetzt hätten wir natürlich singen können: „Die Wanne ist voll…!“, aber das war ja nicht nötig, denn es waren ja genügend Wannen vorhanden. Ein Kollege wurde noch darauf hingewiesen, seine Jacke auszuziehen und ebenfalls in die Wanne zu legen. Insgesamt ging es ziemlich zügig voran. Während die Wannen nun auf dem Band an der Kontrollstelle gescannt wurden, wurden wir gebeten, mit den Armen locker an den Seiten oder leicht abgewinkelt zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden des Körperscanners hindurchzugehen. Das war dann der Moment, wo man ungestraft zu seiner Kollegin oder seinem Kollegen sagen konnte: „Ich glaube, bei Ihnen piepst’s wohl!“. Der Zuruf löste denn auch nur ein Lachen aus. Die Millimeterwellen erfassen den Körper und erkennen Objekte, die unter der Kleidung getragen werden, ohne ein detailliertes Körperbild zu erzeugen. Stattdessen sehen die Kontrollierenden auf einem Piktogramm, ob und wo sich verdächtige Gegenstände befinden, die eine gezielte manuelle Nachkontrolle erfordern. Und dann gilt: „Schuhe aus, Gürtel ab – so viel Striptease gibt’s sonst nur im Kabarett“. Die eingesetzte Strahlung ist sehr schwach, ungefähr tausendfach geringer als die eines Mobiltelefons und stellt somit keine gesundheitliche Gefahr dar. Wenn man selbst durch den Körperscanner durch war, konnte man nun auch auf die Monitore der Mitarbeiter blicken, welche die Gepäckstücke in der Wanne scannten. Die Bildschirme zeigen die Inhalte der Taschen farblich kodiert an, um so verschiedene Materialarten wie Metall, organische Stoffe wie Lebensmittel und auch Kleidung oder künstliche Materialien wie Plastik und Elektronik zu unterscheiden. Dabei werden jedoch keine exakten Fotos angezeigt, trotzdem kann das Personal genau erkennen, um welche Gegenstände es sich handelt. So erscheinen metallische Gegenstände meist in orange oder rot, organische Materialien in grün und andere Materialien in blau oder grau. Auf Nachfrage erfahren wir, dass die Mitarbeiter für die Sicherheitskontrolle spezielle Schulungen zur Erkennung und Bewertung verdächtiger Gegenstände absolvieren. Dieser Blick auf die Monitore war in der Tat sehr interessant. Wir erfahren dann noch, dass die Kontrollpersonen immer wieder getestet werden, ob sie die Kontrollen auch sorgfältig genug durchführen.
Inzwischen sind wir auf dem Vorfeld angelangt und stehen kurz danach vor einem dort geparkten A320 Airbus mit dem Kennzeichen „D-ALFU“ am hinteren Rumpfteil. Beeindruckend die Größe der Düse mit ca. 2 Meter Durchmesser. Der Buchstabe „D“ kennzeichnet Flugzeuge aus Deutschland, und der individuelle Teil „ALFU“ dient als eindeutige Identifikation innerhalb des deutschen Luftfahrzeugregisters.
Beim Weitergehen sehen wir einen Tanklaster auf dem Flugfeld, der zum Betanken einer Maschine fährt. Wenn wir bisher der Ansicht waren, dies sei doch nichts Besonderes, so werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Denn der Tankvorgang eines Flugzeugs unterscheidet sich deutlich vom Betanken eines PKWs, wo man an die Tankstelle fährt und dann meistens volltankt. Beim Flugzeug wird die Menge des benötigten Treibstoffs dagegen durch eine komplexe Berechnung ermittelt. Faktoren für die Treibstoffberechnung sind zum einen Flugstrecke, also Ziel und Flughöhe, dann um welchen Flugzeugtyp handelt es sich, wie sind die Wetterbedingungen, denn Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Temperatur beeinflussen ja den Verbrauch. Des Weiteren spielen die Flugzeit und das Flugprofil ebenfalls noch eine Rolle. Und dann muss natürlich auch noch eine Sicherheitsreserve für unvorhergesehene Situationen mit eingerechnet werden. Also durchaus ein komplexer Vorgang, der meist computergestützt durch eine spezielle Software durchgeführt wird. Und hinzu kommt, dass auch noch Treibstoff für die Rollvorgänge am Boden und für die Betriebsdauer der Hilfsturbine mit eingerechnet werden muss. Diese Daten werden im Flugmanagementcomputer eingegeben, der im Flugzeug die Treibstoffanzeige steuert und die Restmenge überwacht. Als Beispiel wird uns ein Flug von Stuttgart nach Rhodos oder Kreta genannt. Die Entfernung beträgt hier etwa 1.800 bis 2.100 Kilometer bei einer Flugzeit von rund 3 Stunden. Ein Airbus A320 verbraucht für diese Strecke etwa 8.000 Liter Kerosin. Wobei wie oben beschrieben die genaue Menge individuell berechnet wird.
Inzwischen sind wir wieder bei unserem Flughafenbus angekommen und steigen auch gleich ein. Das nächste Ziel ist jetzt die Feuerwache. Doch zunächst sehen wir am Flugfeld einen Schlepper kommen, der zu der Maschine fährt, wo auch die Treppe derzeit zurückgefahren wird. Im Gegensatz zu unseren Autos hat ja ein Flugzeug keinen Rückwärtsgang. Stattdessen wird am Bugfahrwerk eine Schubstange angebracht und das Flugzeug damit rückwärts aus seiner Parkposition geschoben. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A321 mit bis zu 220 Sitzplätzen. Eines der größten Flugzeuge, die regelmäßig nach Stuttgart kommen.
Dann wird unser Blick auf das Tanklager gelenkt. Dieses besteht aus drei großen Tanks mit einem Durchmesser von 17 Metern außen und 14 Metern innen. Sie haben zusammen ein Fassungsvermögen von insgesamt 4,5 Millionen Litern Kerosin. Diese Menge reicht dann für ca. 2 Wochen. Jährlich wird der Flughafen mit etwa 230.000 Kubikmetern Kerosin beliefert, überwiegend durch Tanklastwagen von nahegelegenen Lagern in Heilbronn und Plochingen.
Jetzt steigen wir wieder aus dem Bus, und Herr Dizinger schlägt uns vor, hier ein Gruppenfoto zu machen, quasi als Beweis wie er sagt, dass wir auch wirklich auf dem Flughafen waren. Auf die rote Abdeckung der Triebwerke hingewiesen, wird uns erklärt, dass dieses Flugzeug im Moment nicht benötigt wird. Die Triebwerke sind jedoch sehr empfindliche Bauteile, und die Abdeckungen verhindern, dass Schmutz, Staub, Insekten, Vögel oder sonstige Fremdkörper in den Motor gelangen und Schäden verursachen können. Dann sehen wir noch eine schon deutlich ältere Tupolew TU-154B-2 mit der Kennung D-AFSG. Deren Baujahr war 1973, also schon vor über 50 Jahren. Sie gehört dem Flughafen Stuttgart und wird unter anderem für Feuerwehrübungen genutzt, um reale Bedingungen für Notfall- und Rettungsszenarien zu simulieren, dient aber manchmal auch für sonstige Veranstaltungen und Demonstrationen am Flughafen. Für einen „Partyflug nach Mallorca“ steht sie allerdings nicht zur Verfügung. Außerdem sehen wir sehr viele kleine Flugzeuge, die Privatpersonen oder auch Flugsportvereinen, Flugschulen usw. gehören.
Inzwischen sind wir kurz vor der Feuerwache angelangt. Von da aus können wir den Tower sehen, der sich ja nicht direkt auf dem Flughafengelände, sondern am Ortsrand von Bernhausen befindet, was in Europa einmalig ist. Der Tower ist etwa 30 Meter hoch gelegen und bietet durch seine Lage wie auch durch die technologische Ausstattung eine uneingeschränkte Sicht über das gesamte Flughafengelände und den angrenzenden Luftraum. Die Funkreichweite ermöglicht eine Kommunikation mit Flugzeugen im An- und Abflugbereich in einem Radius von rund 50 Kilometern. Der Tower ist rund um die Uhr besetzt, um den sicheren Start- und Landebetrieb sowie die Rollführung auf dem Vorfeld zu gewährleisten. Und wir erfahren noch, dass die Start- und Landebahn 3.345 Meter lang und 45 Meter breit ist. Damit ist sie auch für größere Maschinen wie die Boeing 747 oder Airbus A310 geeignet, allerdings mit bestimmten Einschränkungen bezüglich des Starts- und Landegewichts.
Und dann sehen (und hören) wir, wie eine Maschine der Türkisch Airlines gerade über die Startbahn braust und abhebt. Dabei hat sie laut Aussage eine Geschwindigkeit von ca. 280 km/h, und in der Höhe kommt sie anschließend auf etwa 800 km/h. Aber auch kleinere Maschinen sehen wir landen und starten. „Winken Sie doch mal, vielleicht werden Sie ja noch mitgenommen!“, so die humorvolle Aufforderung an uns. Und die Passagiere haben tatsächlich mit einem Lächeln zurück gewunken.
Dann tauchte die Frage nach der Bedeutung der blauen und grünen Lampen auf, die wir an der Start- und Landebahn sehen. Wir erfahren, dass diese Beleuchtungen wichtige optische Hilfen für die Piloten und das Bodenpersonal sind, um auch bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen einen sicheren und strukturierten Flugverkehr zu gewährleisten. So markieren die blauen Lampen den Rand der Rollwege, auf denen die Flugzeuge zu ihren Parkpositionen oder Start- und Landebahnen rollen. Die grünen Lampen markieren die Mittellinie dieser Rollwege und helfen damit den Piloten, ihr Flugzeug präzise auf der vorgesehenen Linie zu führen.
Doch was ist jetzt? Plötzlich stehen 2 Polizisten da und fragen nach unserem „Reiseleiter“. Es folgt dann ein etwas längeres Gespräch mit unserem Führer, dem so etwas nach seiner Aussage noch nie passiert ist. Nachdem er sich jedoch ausgewiesen und die Berechtigung für unser Hiersein nachgewiesen hatte, verabschiedeten sich die beiden Ordnungshüter wieder freundlich. Aber sie haben zugegebenermaßen doch für etwas Irritation gesorgt.
„Dann gehen wir wieder rein ins Warme!“ war die nächste Aufforderung von Herrn Dizinger, und wir betraten die Feuerwache Ost. Die Flughafenfeuerwehr ist an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr einsatzbereit. Ihre Aufgabe ist es, den Brandschutz, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst am Flughafen sicherzustellen. Dafür stehen insgesamt etwa 126 hauptamtliche Einsatzkräfte in zwei Wachschichten zur Verfügung, die immer im 24-Stunden-Rhythmus arbeiten. Pro Schicht sind an der Feuerwache Ost mindestens 19 Einsatzkräfte tätig. Die Feuerwache ist nach strengen internationalen Standards ausgerichtet, um binnen maximal 3 Minuten jeden Punkt des Flughafenareals zu erreichen, und ist damit eine hochprofessionelle, moderne Brand- und Rettungseinheit. Die Feuerwehr hat jährlich fast 5.000 Einsätze, davon etwa 4.000 Einsätze direkt am Flughafen. Wobei etwa ein Drittel davon auf den Rettungsdienst entfällt, der von kleinen Verletzungen bis zu lebensbedrohlichen Fällen reicht. Einsätze im Zusammenhang mit Flugzeugen machen allerdings weniger als 5 Prozent aus.
Uns interessiert, über wieviel Fahrzeuge die Flughafenfeuerwehr verfügt. Stand heute sind es laut Angabe 28, darunter auch 4 Löschfahrzeuge mit jeweils 12.000 Litern Wasser und 750 Litern Schaummittel, während die Standard-Tanklöschfahrzeuge ca. 2.500 Liter Wasser mitführen. Und wir erfahren, dass die Tanks in etwa 2 ½ Minuten leer sind. Die Löschfahrzeuge, die wir sehen, haben eine Motorleistung von ca. 750 PS, was eine Beschleunigung von 0 auf 80 km/h in ca. 29 Sekunden ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 120 km/h. Der Anschaffungspreis für so ein Fahrzeug liegt bei etwa 1 Mio. €. Und wir sehen auch noch ein spezielles Rettungstreppenfahrzeug, welches dafür ausgelegt ist, bei erforderlichen Einsätzen Passagiere aus Flugzeugen zu retten, wenn die regulären Fluggastbrücken nicht mehr genutzt werden können. Dieses Fahrzeug hat eine Motorleistung von 230 PS.
Natürlich gibt es viele Übungen und Fortbildungen, um stets für einen evtl. Ernstfall vorbereitet zu sein. So finden z.B. regelmäßige praktische Übungen an echten Flugzeugen oder an mobilen Brandsimulationsanlagen statt. Ein Foto dieser Übungen vermittelt uns einen Eindruck, unter welchen realistischen Bedingungen solche Übungen stattfinden. So brannten bei dieser Übung 8.000 Liter Kerosin und verursachten dadurch eine riesige Hitze und Flammenwand
Dann erhalten wir noch einige Informationen zum Einsatz von sog. Hebekissen, die insbesondere bei der Flugzeugbergung und bei technischen Hilfeleistungen eingesetzt werden. Mit ihnen können schwere Flugzeuge angehoben oder stabilisiert werden. Sie bestehen aus robustem Gummi- oder Gewebe-Material und werden über Druckluft aufgeblasen. Durch das Aufblasen können diese Hebekissen enorme Kräfte entwickeln. So wurde z.B. bei einer Übung ein 75 Tonnen schweres Flugzeug mit drei großen Hebekissen angehoben. Dabei wird die Luftzufuhr präzise gesteuert, um die Höhe und Stabilität ganz exakt einzustellen.
Ein weiteres Objekt fesselt unsere Aufmerksamkeit und wir erfahren, dass es sich hierbei um eine Löschkanone handelt. Ebenfalls ein zentrales Instrument für die Brandbekämpfung, was schnelle und effektive Löschmaßnahmen auch in kritischen Situationen ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein Hochdruck-Düsenstrahlgerät, welches Wasser, Schaum oder andere Löschmittel mit hohem Druck ausstößt, die Flammen damit erstickt, abkühlt und eine Rückzündung verhindert.
Wir verlassen die Flughafenfeuerwehr und treten wieder ins Freie. Nun besuchen wir noch die Gepäckabteilung vom Terminal 1. Als Flugpassagiere wissen Sie ja: Am Gepäckband erkennt man den echten Optimisten: Er glaubt immer fest daran, dass sein Koffer als Erster kommt! Doch dies nur nebenbei. Nach der Ankunft der Maschine werden die Koffer der Passagiere vom Flugzeug in die Gepäckförderanlage des Terminals gebracht. Hier durchlaufen die Gepäckstücke eine Sicherheitskontrolle in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und den Zollbehörden. Anschließend wird das Gepäck zu den Ausgabebändern transportiert. Auf der anderen Seite sieht man die Koffer, die danach zu den Flugzeugen transportiert werden. Heute ist auch hier nicht viel los. Wir erfahren jedoch, dass in Stoßzeiten ein Mitarbeiter bis zu 300 Koffer in der Stunde auf das Band, bzw. vom Band laden muss. Teilweise sind es dann 30 bis 40 Tausend Koffer am Tag, die hier bearbeitet werden müssen.
Die ankommenden Gepäckstücke werden nach der Landung auf dem Förderband transportiert und durchlaufen dabei Röntgen oder CT-Scans zur Detektion verbotener oder gefährlicher Gegenstände. Sofern das technische System Auffälligkeiten erkennt, wird stichprobenartig eine manuelle Kontrolle durch Sicherheitspersonal vorgenommen, bzw. noch eine Zollkontrolle durchgeführt. Herr Dizinger erzählt uns hierzu einen Fall, wo der Zollhund bei einem Koffer sich wie bei einem Fund verhielt. Die Zollbeamten öffneten daraufhin diesen Koffer und stellten fest, dass 1 Kilo Heroin darin enthalten war. Der Witz an der Sache war jedoch, dass im Koffer auch die Adresse des Inhabers angebracht war und die Zollbeamten daher gleich wussten, an wen sie sich wenden müssen. „So isch’s no halt au wieder“, wie der Schwabe sagt. Aber schmunzeln mussten wir schon etwas bei dieser Geschichte.
Als wir unsere Besucherwesten wieder abgegeben hatten und sich beide Gruppen wieder am Ausgangspunkt unserer Führung trafen, bedankten sich Herr Dizinger und Herr Krehl bei uns und hofften, dass sie mit ihren Ausführungen unser Interesse getroffen hätten und uns einen Einblick in die Vorgänge hier am Flughafen Stuttgart vermitteln konnten. Für uns bedankte sich Friedrich Rutte mit herzlichen Worten bei den beiden Herren und versicherte ihnen, dass uns diese Führung sehr gut gefallen hat und wir mit sehr viel Wissen jetzt den Flughafen wieder verlassen. Ein kräftiger Applaus der gesamten Gruppe unterstrich dies ebenfalls deutlich.
Innerhalb der Gruppe gab es jetzt noch Überlegungen. ob wir der „Wolke 7“ noch einen kurzen Besuch abstatten oder stattdessen direkt nach Hause fahren wollen. Letztlich jedoch entschwebte die „Wolke 7“ und wir stiegen wieder in die U 6, die uns zurück zum Hauptbahnhof Stuttgart brachte, um danach von dort wieder mit der S-Bahn nach Ludwigsburg zu fahren. Die Unterhaltungen zeigten, dass es allen Teilnehmenden sehr gut gefallen hat. Daher gilt unser herzlicher Dank Monika Lang und Friedrich Rutte für die Idee zu dieser Führung sowie für die sehr gute Organisation und Durchführung dieses äußerst interessanten Tages. So bleibt mir nur noch zu sagen: „Unsere Führung ist nun gelandet – und wie bei jeder guten Reise gilt: Das Schönste, was man mitnimmt, sind nicht die Souvenirs, sondern die Geschichten. Vielleicht haben Sie ja heute ein paar neue für Ihr Handgepäck gesammelt.“ Denn Sie wissen ja:
„Mit unserm ASP isch’s oifach immer schee!“
Horst Neidhart
Fotos: Margot Herzog, Petra Benub, Sonja Ehnle, Horst Neidhart, Reini Fröhlich und Rolf Omasreither
Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither
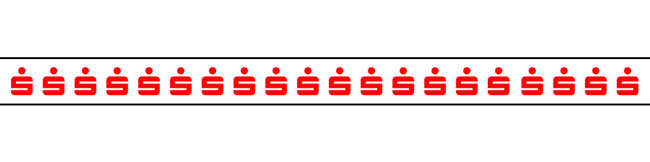
„Die Welt braucht mehr Mamma Mia und weniger Drama“!
So lautete in den 70er-Jahren ein Sprichwort, und ich meine, dass dies gerade auch für heute noch zutrifft. Davon konnten wir uns am 21. August beim Besuch des „Großen ABBA Konzerts – DANCING QUEEN“ in den Burgfestspielen Jagsthausen überzeugen. Werner Knoll, der Organisator dieser ASP-Veranstaltung, hatte in seiner Einladung auf der Homepage dies ja als eine „Knaller-Veranstaltung“ bezeichnet. Und wie Recht er damit hatte, davon konnten wir uns am Abend selbst überzeugen. Doch davon später mehr.
Schon etliche Zeit vor der geplanten Abfahrt um 14:30 Uhr trafen wir uns am ZOB Ludwigsburg. Diesmal konnten sogar auch Angehörige teilnehmen. Wie immer war die Freude über das Wiedersehen sehr groß, aber auch die Neugierde, was wir wohl alle an diesem Tag noch erleben würden. Denn dass es etwas Besonderes werden würde, davon waren wir überzeugt. Apropos erleben: Da unser Bus 10 Minuten früher losfuhr wie eigentlich geplant, hatten einige Teilnehmer ihr erstes ABBA-Erlebnis und konnten nur noch singen: „Mamma Mia, wo ist der Bus?“. Doch clever wie sie waren, haben sie schnell die nächste SB-Bahn nach Bietigheim genommen, denn sie wussten ja, dort hält der Bus für einen Zwischenstopp. Und so konnten alle Betroffene, inclusive Werner Knoll, erleichtert aufatmen. Denn jetzt waren wir vollzählig und 54 Plätze im Bus belegt.
Nun ergriff Werner Knoll das Mikrofon und begrüßte uns alle sehr herzlich. Dabei gab er seiner Freude Ausdruck über die hohe Zahl der Anmeldungen und erzählte uns noch einige Episoden über die Abwicklung der Anmeldung beim Veranstalter. Und wir freuten uns natürlich darüber, dass es ihm gelungen war, den Eintrittspreis von ursprünglich 49,90 € auf letztlich 40,00 € zu ermäßigen. Außerdem gelang es ihm durch die frühzeitige Buchung, gute Sitzplätze für uns zu reservieren.
Kurz vor Heilbronn gab es dann die Herausforderung für unseren Busfahrer. Ab hier musste er den Bus auf einem schmalen, jedoch asphaltierten Feldweg zum Hüttenäckerweg 10 lenken. Dort hatte Werner Knoll im Restaurant „Cafe&Wein“ für uns Plätze reserviert. Allerdings nicht auf der großen Außenterrasse, sondern - was sich als Glückstreffer erwies - im Innenbereich der Lokalität. Denn während wir noch speisten oder Kaffee und Kuchen genossen, ganz nach dem Motto: „Wer erst einkehrt und dann mit ABBA feiert, hat nicht nur den Bauch, sondern auch das Herz voller Freude – Hauptsache, der Windbeutel tanzt nicht vom Teller!“ fing es plötzlich heftig an zu regnen. Was uns jedoch beim Genuss der schmackhaften Speisen und leckeren Kuchen, bzw. Windbeutel, nicht störte.
Nach ca. 2 Stunden Aufenthalt ging die Fahrt wieder weiter durch das schöne Jagsttal bis nach Jagsthausen auf den dortigen Parkplatz nahe der Götzenburg. Die Burg, die sich im Familienbesitz derer von Berlichingen befindet, dient seit 1950 den Burgfestspielen Jagsthausen als Spielstätte. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Burg von der Familie derer von Berlichingen erbaut und später mehrfach erweitert und umgebaut. Sie war die Geburtsstätte des „Ritters mit der eisernen Hand“ Götz von Berlichingen. Und obwohl dieser jedoch nur wenige Jahre seiner Kindheit auf der Burg verbrachte, wird diese durch das bekannte Drama „Götz von Berlichingen“ von Johann Wolfgang von Goethe immer als die Götzenburg bezeichnet. So ist Vielen gar nicht bekannt, dass die Burg auch Wohnort des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog war, der hier die letzten 15 Jahre seines Lebens mit seiner zweiten Ehefrau, Alexandra Freifrau von Berlichingen, verbrachte.
Da bis zum Einlass um 20:00 Uhr noch genügend Zeit war, konnten wir – je nach eigenem Bedürfnis - entweder noch etwas durch das Gelände flanieren oder auf den vorhandenen Stühlen und Bänken Platz nehmen, um sich mit einem Getränk zu erfrischen und einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Inzwischen waren auch schon viele weitere Besucher eingetroffen. Und bald setzten sich alle in Bewegung, um - so wie wir auch - über die vorhandenen Treppen in den Innenhof der Burg zu gelangen. Es dauerte nicht lange, da waren alle Plätze besetzt. Die Spannung stieg spürbar, und unsere Blicke richteten sich auf die Bühne und ihre - wenn auch einfache, so aber doch ausdrucksstarke - Dekoration. Als dann oben auf der Balkonbrüstung die Musiker vom Orchester eintrafen, gab es den ersten - zugegeben noch etwas zaghaften - Applaus, der sich jedoch sofort verstärkte, als der Moderator Björn Luithardt die Bühne betrat und alle Besucher herzlich begrüßte. Es folgten einige Verhaltensregelungen, insbesondere auch der Hinweis, die Handys auszuschalten, da Film- und Tonaufzeichnungen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet seien.
Plötzlich spielte das Orchester die Eurovisions-Hymne „Einer wird gewinnen“ und eine weitere Moderatorin, Marianna McAven, betrat die Bühne. Nach dem letzten Ton der Hymne verkündete sie: „Es ist der 6. April 1974, der Tag des ESC, und ABBAs große Erfolgsgeschichte beginnt.“ Der Moderator fügte hinzu: „Wir befinden uns in Brighton, in England, und zwar im „Dome“. Und die Moderatorin ergänzte humorvoll: „Also auf der Insel des schlechten Wetters, bekannt für gewöhnungsbedürftige Küche und verwirrenden linksseitigen Straßenverkehr“. Da musste das Publikum doch schon lachen. Und noch eine weitere Dame, ebenfalls im eleganten schwarzen Outfit, Katharina Bakthari, betrat die Bühne. Beide Damen traten im Verlauf des Abends sowohl als Moderatorinnen wie auch als Sängerinnen auf, wobei Katharina Bakthari die Rolle der Olivia verkörperte. Und als solche wurde sie nun von Marianna aufgefordert, ihren Song „Long Live Love“ vorzutragen, mit dem sie damals 1974 beim ESC den 4. Platz erreichte. Ein herzlicher Beifall des Publikums war ihr Lohn. Damit hatte der musikalische Teil des Abends vielversprechend begonnen. Doch welchen Platz hatte damals Deutschland erzielt? Die Antwort war: Deutschland trat seinerzeit mit dem Duo Cindy & Bert und dem Lied „Die Sommermelodie“ auf, konnte damit jedoch nicht überzeugen und erreichte letztlich nur den 14. und damit den letzten Platz, gemeinsam mit Norwegen, der Schweiz und Portugal, jeweils mit 3 Punkten. Und auch dieses Lied wurde uns nun vorgetragen, quasi um den Unterschied deutlich zu machen.
Der weitere Verlauf des Konzerts war dadurch gekennzeichnet, dass wir einerseits von den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern in ihrem meist glitzernden und wechselnden Outfits die tollen Songs der ABBA-Band zu hören bekamen, in den kurzen Pausen dazwischen aber durch eine humorvolle Zwischenmoderation auch immer wieder interessante Informationen über die Geschichte der Band und ihre Mitglieder erfuhren.
Da betrat unter kräftigem Beifall ABBA die Bühne, bzw. das Ensemble, welches für uns heute Abend die Band ABBA verkörperte und uns deren Hits präsentierte. Jetzt riss es das Publikum beinahe von den Sitzen, denn nun wurde von ihnen der Song gespielt und gesungen, mit dem ABBA 1974 den ersten Platz belegte: „Waterloo“.
„Waterloo“ ist eine sehr kraftvolle, eingängige Pop-Rock-Nummer, die sich deutlich von den damals üblichen ESC-Beiträgen abhob. Und dazu war die Performance der Band auch noch geprägt durch ihre auffälligen Glitzer-Outfits und der charismatischen Bühnenpräsenz. Was wir ja auch hier und heute sehen und erleben durften. Und wir konnten uns nun selbst ein Bild davon machen, was für eine lebendige, poppige und eingängige Hymne dieser Song ist, der den historischen Moment der Schlacht von Waterloo als Metapher für das Nachgeben in der Liebe nutzt. Wobei dieser Song ja ein sehr energiegeladener Mix aus Glam-Rock und Pop mit einer markanten Melodie ist, die durch die Duett-Gesänge von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad getragen wird. Inhaltlich vermittelt der Song die Einsicht, dass die „Niederlage“ an die Liebe am Ende doch ein Gewinn ist. So lautet eine zentrale Textzeile ja: „I feel like I win when I lose“ („Ich habe das Gefühl, dass ich gewinne, wenn ich verliere“). Zusammengefasst ist „Waterloo“ also ein mitreißendes, cleveres Liebeslied, das historische Symbolik mit poppiger Leichtigkeit verbindet und damit den Start einer der weltweit erfolgreichsten Bands markiert. Den Song hatten Benny Andersson und Björn Ulvaeus komponiert, und der Text stammt von Stig Anderson, einem schwedischen Manager, Musikverleger und Textautor.
Präsentiert wurde uns dieser „Ohrwurm“ von Aron Torka als Benny, Denis Fischer als Björn, Lina Hoppe als Agnetha und Bernadette Hug als Anni-Frid. Und ich gebe gerne zu, dass dies der Moment war, wo der ABBA-Rhythmus allen Besuchern in den Körper fuhr, unsere Hosenbeine zittern ließ, und wir uns alle im Rhythmus mitbewegten. Wirklich ein gelungener, schwungvoller Einstieg, der uns alle in eine Superstimmung versetzte, welche den gesamten Abend anhielt.
Danach gab es wieder einige Informationen. So gilt die schwedische Popgruppe ABBA, die 1972 in Stockholm gegründet wurde, als eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte mit über 400 Millionen verkauften Tonträgern weltweit. Doch wie kam es eigentlich zum Namen ABBA? Ganz einfach: Der Name ABBA setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beiden ehemaligen Paare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad zusammen. Und wir erfuhren noch, dass das eine „B“ im Namen der Band eigentlich aus Versehen verdreht wurde. So hielt Benny Andersson 1976 bei einem Fotoshooting seinen Buchstaben „B“ versehentlich spiegelverkehrt in die Kamera. Allerdings wurde dieser Fehler erst später nach Abschluss der Aufnahmen bemerkt. Nach kurzer Beratung beschlossen Benny und Björn, das spiegelverkehrte „B“ als Teil des Bandlogos beizubehalten, da es „cool“ aussah und ein Wiedererkennungsmerkmal sein würde. Und so wurde das Logo mit dem verdrehten „B“ letztlich zum Markenzeichen von ABBA und symbolisierte quasi gleichzeitig, dass sich beide „B“-Buchstaben einander zuwenden, so wie die Mitglieder der Band ebenfalls. Oder wie der Moderator meinte: „Man kann es drehen und wenden wie man will, ABBA macht einfach alles zu Gold!“
Wir erfuhren noch, dass die Band trotz ihres Erfolges in den Anfangsjahren in Schweden selbst auf Ablehnung stieß, da Kritiker sie für ihre unpolitischen Texte kritisierten und sie nur als eine Pop-Band betrachteten. Im restlichen Europa sowie in Australien, in Lateinamerika und sogar in Japan wuchs dagegen ihre Popularität sehr schnell.
Jetzt wurden uns quasi die ehemaligen Bandmitglieder einzeln vorgestellt. Wir erfuhren, dass Agnetha Äse Fältskog 1950 geboren wurde und bereits mit 6 Jahren das erste Mal als Sängerin auf der Bühne stand. Daneben spielte sie noch Klavier und Cembalo. Auch komponierte sie da sogar schon eigene Songs. Das wichtigste Startjahr für Agnetha war 1967 als sie nach Schottland eingeladen wurde, weil ihr frühzeitiges Talent erkannt und gefördert werden sollte. In diesem Jahr veröffentliche sie auch ihre erste Single „Jag var så kär“ „(Ich war so verliebt“). Dies war dann auch ihr erster großer Erfolg in Schweden. Und wir erfuhren weiter, dass Agnetha 1969 in einer TV-Sendung als Sängerin auftrat und dabei zum ersten Mal Björn Ulvaeus traf, mit dem sie dann später eine Beziehung einging. Die Hochzeit folgte im Jahr 1971.
Björn Ulvaeus wurde 1945 in Göteborg geboren. Wie uns gesagt wurde, hätte Björn mit 13 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, weil er den Blockflöten-Unterricht zu langweilig fand. Lieblingsband von ihm waren die Beatles, die er angeblich heimlich nachts unter der Bettdecke gehört hat. Seine musikalische Karriere begann Anfang der 60er Jahre als Gitarrist der Folk-Band „The Partners“, die später zu den „Hootenanny Singers“ wurde. Diese Band war in Schweden sehr erfolgreich und verband schwedische Volksmusik mit amerikanischem Folk. Diese frühen Erfahrungen gaben ihm die Basis und Routine als Musiker. Jedoch trieb ihn sein Wunsch nach moderner, englisch inspirierter Popmusik zu neuen kreativen. Partnerschaften. Im Rahmen lokaler Auftritte lernte er 1966 dann Benny Andersson kennen. Anfang der 70er Jahre traten Björn und Benny nun als Duo auf.
Benny Andersson wurde 1946 in Stockholm geboren. Schon als Kind begann er sich für Musik zu begeistern und erhielt in seiner Kindheit Akkordeonunterricht von seinem Vater und seinem Großvater. Außerdem begann er mit zehn Jahren Klavier zu spielen und brachte sich einen großen Teil seiner Fähigkeiten selbst bei. 1968 lernte er Anni-Frid kennen und arbeitete als ihr Produzent.
Anni-Frid Lyngstad, auch Frida genannt, wurde 1945 in Norwegen geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter kam sie als Kleinkind mit ihrer Großmutter nach Schweden. Schon mit zwölf sang sie in einer Band. Ihre professionelle Musikkarriere begann nachdem sie in einem TV-Auftritt im Wettbewerb für die Teilnahme am ESC den 4. Platz belegt hatte und danach von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen wurde. 1968 lernte sie auf einer Tournee ihren späteren Ehemann Benny kennen. Und mit Björn, Agnetha und Anni-Frid gründete Benny 1972 die Gruppe ABBA. In der Zeit von 1973 bis 1982 veröffentlichte ABBA acht Studioalben, und bis 2020 kamen weitere 36 dazu. Außerdem folgte noch eine Reihe von Singles mit schwedischen, englischen, französischen, spanischen und deutschen Texten.
Jetzt bekamen wir die Frage gestellt, was Knäckebrot und ABBA miteinander zu tun haben? Nun ist Knäckebrot ja in Schweden ein Kulturgut mit langer Geschichte. Und ABBA ist in Schweden auch eine sehr bekannte Marke für Fischkonserven. Doch darum ging es bei dieser Frage der Moderatorin nicht. Erst der Hinweis auf die Fernsehsendung „Wetten, dass…?“ half dann weiter. So ging es in dieser Fernsehsendung damals darum, dass eine Kandidatin behauptete, anhand des Geräusches, mit dem ihr Ehemann ein Knäckebrot kaut, verschiedene ABBA-Songs zu erkennen. Und diese Szene wurde uns jetzt auf der Bühne dargestellt. Das Publikum sollte nun zeigen, ob es die entsprechenden Songs ebenfalls erkennen würde. Eine sehr lustige, ja skurrile und gleichzeitig aber auch sehr krümelbehaftete Vorführung, die natürlich zu großem Lacherfolg führte, quasi ganz nach dem Motto: „Aus ABBA wird Knabba“, wie es der damalige Fernsehmoderator Markus Lanz ausdrückte. Und auch hier im Publikum gab es heute eine Gewinnerin, die als Prämie die Packung mit dem restlichen original-schwedischen Knäckebrot erhielt. Anschließend wurde uns wieder einen Song präsentiert: „Chiquitita, tell me what's wrong…“. Der lustige Gag der Regisseurin, Eva Hosemann: Die Sängerin Agneta sitzt traurig und tiefsinnig an einem Nebentisch und verspeist langsam und in Gedanken versunken eine „Chiquita Banane“.
Die Stimmung stieg wieder nach oben und das Publikum sang „Mamma Mia“ kräftig mit. Auch bei den weiteren Songs gab es kein Halten mehr, ein Großteil der Besucher klatschte im Stehen und alle bewegten sich im Takt. Alles in uns will in Bewegung geraten und fröhlich sein. Verstärkt wird dies noch durch die nächsten Titel „Gimme! Gimme! Gimme!“ und „Super Trouper“. Etwas ruhiger wurde es wieder beim Titel „Fernando“. Dieser Song beschreibt ja die Geschichte zweier mexikanischer Freiheitskämpfer, die im 19. Jahrhundert nachts an einem Lagerfeuer am Rio Grande sitzen und über ihre Taten nachdenken. Fernando spielt dabei Gitarre. Das war ein schöner Kontrast zu den vorher gehörten Songs. Mit mehr als 10 Millionen verkauften Platten wurde „Fernando“ ABBAS kommerziell erfolgreichste Single und landete in vielen Ländern auf Platz eins.
„Money, Money, Money“ lässt dann manchen der Besucher etwas nachdenklich werden beim Gedanken der Fixierung auf Geld als Glücksquelle. Eine Phase, die auch die ABBA-Mitglieder damals durchmachten. Generell kann man feststellen, dass die Ehescheidungen der Paare Agnetha und Björn im Jahr 1980 und von Anni-Frid und Benny im Jahr 1981 bereits einen spürbaren Einfluss auf die Zusammenarbeit und Banddynamik hatten. Denn nach diesen privaten Krisen veränderte sich innerhalb der Band die Atmosphäre grundlegend. Viele Songs spiegelten diese Entwicklung auch wider und handeln an Stelle von Liebe, Unbeschwertheit und Partystimmung nun von Trennung, Schmerz und Identitätskrisen. So handelt auch der Song „Knowing me, Knowing you“ von einer zerbrochenen Liebesbeziehung. Björn schrieb die Zeilen damals inspiriert von seiner Trennung von Agnetha. Und sinngemäß übersetzt bedeuten sie ja: „Ich bin ich, Du bist Du!“ Björn beschrieb den Text als die Metapher eines Mannes, der durch ein leeres Haus geht, quasi als Sinnbild für die Scheidung und den Abschied.
Der Verlust des früheren gemeinsamen Bandspirits führte zusehends zu Distanz und Spannungen innerhalb der Gruppe, und dies kam auch in der folgenden Moderation zur Geltung: „1983 war es dann aus mit den rosigen Zeiten…“, so das Zitat. Warum? Was war geschehen? Nun, 1983 war für ABBA deshalb ein einschneidendes Jahr, weil die Gruppe nach ihrem letzten gemeinsamen Live-Auftritt im Dezember 1982 offiziell eine kreative Pause einlegte, was letztlich aber als faktisches Ende der Band betrachtet werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt arbeiteten alle 4 Bandmitglieder an eigenen Musikprojekten. So starteten Agnetha und Anni-Frid eigene Solokarrieren mit englischsprachigen Soloalben. Björn und Benny dagegen begannen gemeinsam als Musical-Komponisten zu arbeiten.
Doch nun kam wieder ein „Knaller“: Wir wurden aufgefordert, unsere Handys einzuschalten, die Fotoapparate hervorzuholen, um den folgenden Höhepunkt der Veranstaltung „einzufangen, festzuhalten und als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen“. Es folgte der Auftritt der Band mit dem Super Hit „Dancing Queen“. Da hielt es natürlich keinen mehr auf den Stühlen. In diesem Song geht es nicht um Liebe oder Seelenschmerz, es ist ein Tanzlied ohne jeden Hintergedanken, ohne Kummer und Schwermut. Das wird auch in seinem Refrain deutlich: „You can dance, you can jive, having the time of your life / See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen“. Hier ist die ganze unbeschwerte Freude zu hören. Und manche von uns erinnerten sich sicherlich gerne an die Zeit zurück, wo sie selber noch die „Dancing Queen“ oder der „King auf der Tanzfläche“ waren.
„Dancing Queen“ stieg damals sofort auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Schweden und England und erreichte als einzige Single sogar Platz 1 der US-Charts. Und auch hier im Burghof hörten die lauten „Zugabe“-Rufe nicht mehr auf. Wie schön, dass die Band dieser Aufforderung zur Freude der Besucher auch folgte. Mit „Thank you for the Music“ ging die Vorstellung schließlich zu Ende und der Moderator bedankte sich im Namen aller Mitwirkenden bei den Besuchern, die noch eine Weile kräftig Beifall klatschten. Doch dann leerten sich die Stuhlreihen und alles strebte dem Ausgang zu.
Noch immer mit der Melodie „Thank you for the music!“ im Ohr verließen auch wir den Burghof und gingen zu unserem Bus zurück. Schnell waren wieder alle Plätze eingenommen und die Heimfahrt konnte losgehen. Natürlich gab es jetzt genügend Gesprächsstoff über das soeben Erlebte. Das Konzert von ABBA war ein mitreißendes und unvergessliches Erlebnis, das zeitlose Musik mit moderner Inszenierung meisterhaft vereinte. Von Beginn an fesselte die Performance durch eine perfekte Symbiose aus musikalischer Präzision, mitreißender Energie und einer visuellen Gestaltung, die uns in eine magische Atmosphäre eintauchen ließ. Neben der exzellenten musikalischen Darbietung überzeugte das Konzert durch eine innovative Bühnenshow, die durch Licht und sorgfältig choreografierte Momente auch für visuelle Highlights sorgte. Einfach ein echtes Gesamtkunstwerk. So war es auch kein Wunder, dass die Stimmung im Burghof elektrisierend war und wir von der Leidenschaft der Künstler regelrecht mitgerissen wurden. Einfach musikalisch brillant, visuell atemberaubend und emotional tief berührend. Ein Abend, der uns allen sicher lange in Erinnerung bleibt durch seine emotionale Verbindung, die nicht nur Herzen öffnete, sondern die noch lange nach dem letzten Ton nachhallt.
Wir alle waren uns einig, dass es in der Tat eine „Knaller-Veranstaltung“ war, so wie es Werner Knoll ja angekündigt hatte. „Thank you for this Event!“ lieber Werner Knoll. Herzlichen Dank für die Idee dieser Veranstaltung generell, sowie für die hervorragende Organisation und Durchführung. Ein herzlicher Dank von uns gilt aber auch unserer Kreissparkasse für die Unterstützung des ASP. Und ein weiterer Dank gebührt unserem Busfahrer, der uns wieder sicher nach Ludwigsburg zurückbrachte, natürlich mit einem kurzen Zwischenstopp in Bietigheim. “Tschüss, bis zum nächsten Mal!“ war dann immer beim Verabschieden zu hören. Denn alle freuen sich ja stets aufs Neue auf die Events unseres ASP-Teams. Wissen wir doch alle längst: „Mit unserm ASP isch’s oifach immer schee!“
Horst Neidhart
Fotos: Petra Benub, Horst Neidhart,Rolf Omasreither
Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither
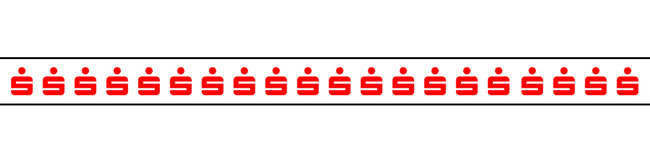
„Am Kocher Hall die löblich Statt, vom Saltzbrunn ihren Ursprung hatt.“
Nein, das sind keine Schreibfehler, sondern dieser Spruch ist ein historischer Stadtlob-Vers aus dem Jahr 1643 und wurde auf einer sog. Neuhaustafel von Hans Schreyer festgehalten, der die zentrale Bedeutung des Salzhandels für die Stadtentwicklung unterstreicht und dabei gleichzeitig den historischen Stolz auf dieses Erbe widerspiegelt. Und der Spruch geht weiter: „Das Salwerk Gott allzeit erhalt und ob der Stadt mit Gnaden walt.“
Und wenn in Schwäbisch Hall einer sagt: „ Ha, du bisch mir a rechter Sieder!“, ist das auch nicht als Schimpfwort gemeint, sondern eher als eine humorvolle Anerkennung mit einem kleinen Augenzwinkern. Doch dazu später mehr, denn erst einmal trafen sich 40 ehemalige Kolleginnen und Kollegen am 24. Juli 2025 morgens um 09.00 Uhr am Ludwigsburger ZOB, um an der Ausfahrt nach Schwäbisch Hall teilzunehmen. Wie immer herrschte große Freude über das Wiedersehen, gepaart mit gespannten Erwartungen, was wir heute bei diesem Event unseres ASP-Teams alles sehen und erleben würden. Wobei wir die erste Berührung mit dem Thema Salz noch vor der Bus-Abfahrt hatten, denn das Organisationsteam dieser Veranstaltung, die beiden Kolleginnen Frau Anne Tschürtz und Frau Gabi Ivenz, verteilten Brezeln an uns. Welche nette Überraschung, die wir natürlich mit Freude gerne annahmen.
Dann begrüßte uns Anne Tschürtz sehr herzlich und gab uns einen kurzen Überblick über den Verlauf des heutigen Tages. Danach hieß es „bitte einsteigen!“ und Raphael, unser Busfahrer, begrüßte uns ebenfalls herzlich und startete den Bus. Noch ein kurzer Zwischenstopp in Bietigheim, wo noch einige Teilnehmer zustiegen. Die weitere Fahrt verlief zügig und zwischen den Kolleginnen und Kollegen entwickelte sich rasch eine intensive Unterhaltung. Und manch einer unter uns vergaß dabei, den Blick auch mal nach draußen in das schöne Hohenloher Land zu richten. Es gab einfach zu viel zu erzählen.
Ja, und dann waren wir auch schon in Schwäbisch Hall angekommen und es hieß wieder aussteigen, denn jetzt sollte es ja gleich mit dem Rundgang durch Schwäbisch Hall losgehen. Der Blick zum Himmel zeigte, dass auch hier Anne Tschürtz gute Vorarbeit geleistet hatte. Die Regentropfen fielen erst am späten Nachmittag. Hier am Platz vor der St. Michaels-Kirche erwarteten uns bereits die beiden Damen, Frau Amthor und Frau Däuber, die uns dann ihre schöne Stadt zeigen wollten. Dazu teilten wir uns in zwei Gruppen auf, ich gehörte der Gruppe von Frau Däuber an.
Über Schwäbisch Hall könnte man ja wirklich sehr viel berichten, doch das würde diesen Rahmen sprengen, und daher nur ein paar Anmerkungen zur Geschichte der Stadt und der Salzgewinnung. Hall entstand rund um eine Salzquelle, deren Nutzung bereits keltische Wurzeln hat. Im Hochmittelalter prägte die Salzgewinnung – das sogenannte „weiße Gold“ – Geschichte, Wohlstand und Macht der Stadt. Die „Sieder“, Angehörige der einflussreichen Sieder-gemeinschaft, erhielten ihre Anteile als erbliches Lehen, oft war sogar eine lebenslange Rente für ihre Nachkommen damit verbunden. Diese Salzgewinnung machte Schwäbisch Hall zu einer reichen und bedeutenden Reichsstadt – davon zeugen viele prächtige Bauten in der Stadt. Einige davon haben wir bei unserem Rundgang auch betrachten können. Doch zunächst noch eine Frage: Was hat die Kreissparkasse Schwäbisch Hall mit der Salzgewinnung zu tun?
Die Antwort gab uns Frau Däuber: Als die Kreissparkasse in den Jahren 1981-1983 erweitert wurde, haben umfangreiche archäologische Ausgrabungen wichtige Funde zur frühmittelalterlichen Salzgewinnung geliefert: So fand man mehrere hölzerne Brunnenanlagen, die als Schacht- oder Kastenbrunnen gebaut waren. Sie stammen zum Teil aus der Karolingerzeit (8.–9. Jahrhundert) und sind Belege dafür, dass der Standort nach einem Erdrutsch um 800 n. Chr. neu erschlossen wurde. Man entdeckte außerdem Holztröge und Reste von Holzleitungen, mit denen die Sole aus den Brunnen in die Siedehäuser geleitet wurde. Gefundene Bruchstücke von Siedepfannen und Öfen belegen die Technik der Salzsiederei. Und man fand auch Alltagsgegenstände der Salinenarbeiter, darunter auch Funde, die eine Nutzung der Solequelle schon in der Keltenzeit um 500 v. Chr. belegen, so zum Beispiel Keramikfragmente aus vorrömischer Zeit. Einige der Originalfunde sind im Hällisch-Fränkischen Museum zu besichtigen.
Dies vorweg zur Einstimmung. Doch dann startete unsere Führung oberhalb der St. Michaelskirche. Bevor wir jedoch diese betraten, richtete Frau Däuber unsere Blicke auf das Bonhoefferhaus und das dort angebrachte Familienwappen: ein goldener, gekrönter Löwe, der eine Bohnenranke in der Tatze hält. Dieses Motiv ist ein sogenanntes „redendes Wappen", denn die Bohnenranke nimmt Bezug auf den Familiennamen (Bon/hoeffer als Anspielung auf die Bohne). Der Löwe steht als heraltisches Symbol für Stärke und Macht. Das barocke Portal und das Familienwappen dokumentieren den gesellschaftlichen Aufstieg dieser bekannten Haller Bürgerfamilie. Schon ein einzigartiges Motiv, welches wir dann auch später noch einmal in der St. Michael-Kirche auf Stiftertafeln entdecken.
Dann zieht die breite Freitreppe, die sich vom Marktplatz aus mit ihren 54 Stufen zur Kirche hinaufzieht, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Diese Treppe ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern verwandelt sich im Sommer zur spektakulären Bühne der traditionsreichen Jedermann-Festspiele. Auf dieser Treppe wird seit 100 Jahren Theater gespielt. Sie ist eine der bekanntesten Open-Air-Spielstätten Deutschlands. Unsere Führerin erzählt uns dann noch kurz von den Aufführungen der „West Side Story“. Hier wird die große Treppe zur Straße New Yorks – die Stufen werden Spielfläche, Tribüne und Tanzfläche. Das Ensemble tanzt, singt und spielt mitten auf den Stufen und oft auch zwischen dem Publikum. Und auf der Treppe liegen die Trümmer der zerbrochenen Freiheitsstatue, Fackel und Strahlenkranz. Gerade so, als wäre der Traum von Amerika jetzt hier zerplatzt, und damit auch der Traum von Freiheit und Chancengleichheit.
Wir erhalten dann noch Hinweise auf weitere Stücke, die hier aufgeführt werden oder wurden, wie z.B. Jesus Christ Superstar. Und Frau Däuber lenkt unsere Blicke auf die besondere Bestuhlung. Hier sind die Sitzreihen der Form und Steigung der Treppe angepasst, damit alle Zuschauer eine ausgezeichnete Sicht auf das Bühnengeschehen haben. Und manche unter uns können dies aus eigener Erfahrung bestätigen.
Dann gelten unsere Blicke dem gegenüberliegenden, imposanten Rathaus. Dies ist ein bedeutendes barockes Bauwerk aus dem Jahr 1735 und prägt den westlichen Abschluss des historischen Marktplatzes. Es wurde nach dem verheerenden Stadtbrand von 1728 an der Stelle der ehemaligen Jakobskirche errichtet. Der Entwurf stammte vom Ludwigsburger Baumeister Johann Ulrich Heim und realisiert wurde der Bau von dessen Neffen Eberhard Friedrich Heim. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Rathaus am 16. April 1945 durch Bomben bis auf die Grundmauern zerstört. Die Stadt entschied sich für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau von 1945 bis 1955, bei dem Farbfotos aus den 1940er-Jahren als Vorlage dienten. Ins Auge fällt die dreigeteilte, reich verzierte Fassade mit Säulen, Pilastern, Ziergiebeln und barocken Stuckaturen. Der auf der Fassade sichtbare doppelköpfige Adler war ein staatliches und symbolisches Zeichen der Reichsunmittelbarkeit, also der direkten Zugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich ohne Zwischenherrschaft. Dies betonte, dass Schwäbisch Hall eine eigenständige und privilegierte Reichsstadt war.
Frau Däuber kommt noch einmal kurz auf den verheerenden Stadtbrand von 1728 zu sprechen. Dieser gilt als eine der schwersten Katastrophen der Stadtgeschichte. Innerhalb von etwa 15 Stunden wurden große Teile der Altstadt zerstört, insgesamt fast zwei Drittel des historischen Stadtkerns. Der Wiederaufbau dauerte mehrere Jahre und erfolgte überwiegend im damals modernen Barockstil. Er prägt das Stadtbild bis heute. Besonders wichtig war dabei ein sofortiger Baubeginn an der Saline im Haalbereich, um die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Stadt, die Salzgewinnung, schnell wiederherzustellen. Bis Ende 1729 waren dann bereits wieder 121 Häuser neu errichtet, was eine beachtliche Leistung angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen war.
Jetzt war es an der Zeit, die Kirche zu betreten. St. Michael, die Stadt- und Hauptkirche von Schwäbisch Hall wurde bereits 1156 geweiht, damals noch als eine romanische Basilika. Reste davon sind heute noch an der Westseite und im Unterbau zu erkennen. Typisch romanisch waren die Rundbögen, die massiven Mauern und auch die wuchtigen Pfeiler. Ab dem 13. Jahrhundert wuchs Schwäbisch Hall zu einer reichen Reichsstadt, das brachte nicht nur Geld, sondern förderte auch Ambitionen. Die Bürger wollten eine Kirche, die den Reichtum und den Status der Stadt als freie Reichsstadt widerspiegelt. Und so wurde die Kirche in mehreren Bauphasen gotisch erweitert, u.a. durch höhere Gewölbe, spitzbogige und größere Fenster, Turmhaube und später dann noch während der Chorbauphase um 1507 die berühmte Freitreppe vor dem Westportal.
Einem Kollegen fielen beim Eintreten in die Kirche längliche Einkerbungen neben dem Eingang auf. Frau Däuber erklärte uns dann, dass es sich hierbei um sog. „Wetzscharten“ handelt. Ursprünglich vermutlich durch das Schärfen oder Wetzen von Waffen direkt an der Steinmauer. Aber sie dienten auch zum Gewinnen von Steinabrieb (Sand, Pulver), der als heilkräftig galt.
Wie sagte unsere Führerin beim Eintritt in die Kirche so nett: „Die Kirche wirkt durch ihre Ausstattung noch katholisch, aber seit 500 Jahren sind wir evangelisch.“ In der Kirche fällt einem sofort der dramatische Raumkontrast auf: ein eher niedriges Langhaus mit einem deutlich höheren Chor, was sehr eindrucksvoll wirkt. Der gotische Chor wurde zwischen 1495 und 1525 errichtet. Dazu wurde der vorherige romanische Chor jedoch vollständig abgebrochen. Das prächtige spätgotische Netzgewölbe im Chorbereich zeichnet sich durch seine komplexe Rippenführung und den kunstvollen Schlusssteinen aus.
Dann lenkt Frau Däuber unsere Blicke auf den Hochaltar der Kirche, einem bedeutenden spätmittelalterlichen Flügelaltar aus der Zeit um 1460. Wie wir erfahren, stammt er aus einer Brabanter Werkstatt in den Niederlanden. Der Altar zeigt die Passion und Auferstehung Jesu und besteht aus einem breiten Schrein mit einem figurenreichen Schnitzrelief sowie zwei Flügelpaaren, die jeweils bemalte Tafeln auf Vorder- und Rückseite haben und den Schrein vollständig verschließen können. Er gilt als herausragendes Beispiel spätgotischer Kunst und ist eines der bedeutendsten Kunstwerke der Kirche. Die detaillierte Gestaltung und die lebendige Darstellung machen ihn zu einem eindrucksvollen Zeugnis der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunderts.
Das Kruzifix über dem Hochaltar stammt aus der Werkstatt des Ulmer Bildhauers Michael Erhart und wird auf das Jahr 1494 datiert. Der Gekreuzigte wird darauf naturalistisch als leidender Sterbender dargestellt, was die Intensität und Emotionalität der Darstellung betont. Dieses spätmittelalterliche Kruzifix gilt ebenfalls als eines der wertvollsten Ausstattungselemente der Kirche, welches Johannes Brenz während der Reformation vor dem Bildersturm bewahrte. Der Bildersturm während der Reformation war eine Folge der religiösen Umbrüche im 16. Jahrhundert, bei dem auf Weisung reformatorischer Theologen und Obrigkeiten zahlreiche religiöse Bildwerke wie Gemälde, Skulpturen, Kirchenfenster und andere Darstellungen von Christus entfernt, teilweise gewaltsam zerstört, aber auch manchmal verkauft wurden. Johannes Brenz war Prediger in Schwäbisch Hall, wo er intensiv die Reformation vorantrieb. Er sorgte hier für die Abschaffung der Messe, die Auflösung der Klöster und die Einführung evangelischer Gottesdienste. Aufgrund seiner entschiedenen Haltung gegen die Rekatholisierung musste er jedoch 1548 aus Schwäbisch Hall fliehen und wirkte ab 1550 am Hof Herzogs Christoph von Württemberg mit.
Frau Däuber wies uns dann noch auf eine weitere Besonderheit hin: Über dem Kruzifix befindet sich eine Schrifttafel, die den sogenannten Kreuztitel zeigt. Dieser Text ist in drei Sprachen verfasst: Latein, Griechisch und Hebräisch. Die dreisprachige Inschrift über dem Kruzifix verweist auf die historische Praxis, die Anklage gegen den Gekreuzigten in mehreren Sprachen anzubringen: „Jesus von Nazareth, König der Juden“.
Danach werden wir auf die vielen prächtigen Epitaphe von vornehmen Bürgern hingewiesen. So gibt es in der Kirche über 50 derartige Erinnerungsmale für Verstorbene. Diese hohe Anzahl ist Ausdruck der großen Frömmigkeit und des Bestrebens um das Seelenheil der Verstorbenen, die im 14. Jahrhundert besonders stark ausgeprägt war. Die zahlreichen Epitaphe finden sich besonders zwischen den Fensteröffnungen der Kirche und dokumentieren den Reichtum und auch die Kunstsinnigkeit der alten Haller Bürgerfamilien. Sie sind kunstvoll aufgebaut, mit Reliefs, bildlichen Darstellungen, Wappen und Inschriften, die das Leben und den Status der Verstorbenen würdigen. So sehen wir einige Epitaphe der Familien Bonhoeffer.
Die Familie Bonhoeffer stammte ursprünglich aus den Niederlanden und ließ sich im 16. Jahrhundert in Schwäbisch Hall nieder. Seit 1513 lebte die Familie in der Stadt, wobei die Nachkommen zunächst als Goldschmiede und später auch als Ärzte oder Pfarrer tätig waren. Die Familie stellte 78 Ratsherren, deren Porträts sich in der Michaelskirche befinden, und mehrere Familienmitglieder bekleideten das Bürgermeisteramt. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, wurde 1906 in Breslau geboren. Er wuchs in Berlin auf und war ein Mitglied der Bonhoeffer-Familie. Obwohl er nicht in Schwäbisch Hall geboren wurde, sind seine Vorfahren dort ansässig, und die Epitaphe in der Stadtkirche St. Michael erinnern an seine familiären Wurzeln. In diesem Zusammenhang tauchte dann auch der Begriff „Stettmeister“ oder auch „Stättmeister“ auf. Der Stettmeister stand an der Spitze des Inneren Rats der Stadt und war der höchste Verwaltungsbeamte, entspricht dem heutigen (Ober-)Bürgermeister.
Dass in den Epitaphen sehr viel Symbolik enthalten ist, zeigt uns Frau Däuber dann am Epitaph von Johann Lorenz Sanwald. Dieses stammt aus der Zeit um 1774/1778 und wurde 6 Jahre vor dem Tod des Verstorbenen von ihm selbst in Auftrag gegeben, damit es nach seinen Wünschen gefertigt wird. Das Gemälde oder Relief im Mittelpunkt zeigt den Verstorbenen und steht für die persönliche Erinnerung sowie die Würdigung der herausragenden Persönlichkeit innerhalb der Stadtgesellschaft. Die meist vergoldeten Rahmenornamente symbolisieren Wohlstand, Bedeutung und bleibenden Ruf. Unten am Epitaph befindet sich eine Gestaltung mit Skelett und Lebensbaum. Das Skelett symbolisiert den Tod und die Vergänglichkeit alles Irdischen. Dagegen steht der Lebensbaum für Leben, Hoffnung und Auferstehung im Kontext für das ewige Leben nach dem Tod. Dass das Skelett die Wurzeln des Baumes packt oder ausreißt, stellt die unmittelbare Macht des Todes über das irdische Leben dar, weist aber zugleich auch auf die ewige Verbindung von Leben und Tod hin.
Frau Däuber weist uns dann noch auf den kleinen Jungen hin, der die Sanduhr in der Hand hält und weiter oben auf die weibliche Figur mit der Waage der Gerechtigkeit in der einen Hand, und dem Schwert in der anderen Hand. Sie bekrönt den Verstorbenen mit einem Lorbeerkranz und stößt mit dem Fuß den Teufel weg, der einen Geldsack in der Hand hat. Der Engel rechts bläst mit der Posaune zum Jüngsten Gericht, während dem anderen Engel die Münzen aus der Hand kullern. Ganz oben dann noch das Auge Gottes und darüber nochmal ein Engel, auf dessen Finger der Heilige Geist in Form einer Taube sitzt. Ich gebe gerne zu, dass dieses Kunstwerk uns alle doch sehr beeindruckte, zumal wir es erst durch die guten und kompetenten Erläuterungen unserer Führerin bewusst betrachteten. Zum Schmunzeln erfuhren wir dann noch die Geschichte, wonach bei einer früheren Restaurierung der Restaurator einen Anruf bekam: „Kommen Sie ganz schnell in die Kirche, denn der Heilige Geist ist wieder da!“ – Ja, wo war er denn bisher? Ganz einfach, er war irgendwann hinter das Epitaph gefallen und keiner hatte ihn bisher wiedergefunden. War ja auch eine Taube, und die können nun mal fliegen. Womit das Wort „runtergeflogen“ eine ganz andere Bedeutung erlangt.
Dann standen wir vor einer Seitennische und bekamen zwei historische Dokumente gezeigt. Das eine zeigt Thomas Schweicker sitzend und mit den Zehen seines rechten Fußes einen Federkiel haltend. Und wir erfahren, dass Thomas Schweicker ohne Arme geboren wurde. Trotz seiner Behinderung konnte er mit den Zehen seines rechten Fußes einen Federkiel halten und damit kunstvoll und professionell schreiben. Er wurde zu einem berühmten Kalligraphen seiner Zeit. Seine Fähigkeiten machten ihn weit über Schwäbisch Hall hinaus bekannt, unter anderem am Hof in Heidelberg und beim Kaiser Maximilian II.. Sein Lebenswerk ist ein eindrucksvolles Beispiel für Selbstbestimmung und Talent trotz körperlicher Einschränkungen. Sein Leben wird als Symbol für die Überwindung von Behinderung und als Inspiration gewürdigt. Das Epitaph wurde von ihm selbst entworfen und enthält eine poetische und persönliche Inschrift. Es beschreibt seine Behinderung als „Werk Gottes“ und als Teil der Natur. Darin fordert er die Menschen auf, für ihre Gesundheit dankbar zu sein.
Nachdenklich gehen wir wieder ein paar Schritte weiter und stehen vor einem kleineren spätgotischen Schnitzaltar aus dem Jahr 1509, dem sog. „Annenaltar“ oder auch „Sippenaltar“ genannt. Im Mittelpunkt dieses Altars steht eine Figurengruppe der heiligen Sippe: Mutter Anna und ihre Tochter Maria. Erst als wir gefragt wurden: „Was fehlt hier?“ schauten wir noch etwas intensiver hin. Und schon kam auch die Antwort aus unserer Gruppe: „Das Jesuskind!“ Und in der Tat, die Figur des Jesuskindes fehlt tatsächlich, entweder durch Diebstahl oder durch Verlust. Dieses Fehlen ist historisch und kunsthistorisch belegt, ohne auf die Gründe einzugehen.
Dann begeben wir uns unter den Chorraum der Kirche und blicken im dortigen Beinhaus auf die Vielzahl der dort aufbewahrten Gebeine, vor allem Schädel und Knochen. Ursprünglich befand sich das Beinhaus außerhalb der Kirche. Nach der Räumung der Gräber auf dem alten Friedhof wurden zahlreiche Gebeine dann im jetzigen Beinhaus unter dem Chor der Kirche aufbewahrt. Damit konnte das Problem des knappen Begräbnisraumes in der Stadt gelöst werden. Heute ist das Beinhaus eines der bedeutenden mittelalterlichen Beinhäuser Süddeutschlands und stellt ein eindrucksvolles Zeugnis der Sepulkralkultur dar, also der umfassenden Kultur rund um Sterben, Bestattung und Trauer.
Jetzt kam Frau Däuber auf das Jahr „Achtzehnhundertunderfroren“ zu sprechen, denn wir standen vor dem sog. „Hungerkasten“. Das Jahr 1816 war ungewöhnlich kalt und wird auch als „Jahr ohne Sommer“ bezeichnet. Eine Folge des im April 1815 in Indonesien ausgebrochenen Vulkans Tambora, dessen Asche sich über ganz Europa und Nordamerika ausbreitete, und so dafür sorgte, dass die Sonnenstrahlen die Erde nicht erreichen konnten. Auf den Feldern konnte nichts wachsen, viele Menschen verhungerten, auch in Schwäbisch Hall. Der Hungerkasten in der Kirche erinnert an diese Hungersnot und an ihr Ende. Oben im Kasten sind Brote von damals aufgehoben. Sie wurden immer teurer und kleiner. Unter den Broten sieht man die erste Getreidegarbe, für die in der Kirche am 2. August 1817 ein großer Dankgottesdienst gefeiert wurde, als es endlich wieder eine Ernte gab. Diese Ereignisse sind ein wichtiger Teil der lokalen Geschichte und der damit verbundenen Erinnerungskultur.
Als man die Kirche neu renoviert hat, hat man einen Grundstein neu gelegt. Wir sehen nun, was im alten Grundstein enthalten war: Getreide (Dinkel, Roggen, Ähren), also Dinge, die für die damaligen Menschen wichtig waren. Aber auch Hellermünzen, die sich im Holzkohlenbehälter befanden, und auch noch ein Weinglas.
Doch nun richteten wir unsere Blicke nach oben, denn da fiel uns etwas auf, was wir nicht mit der Kirche in Verbindung bringen konnten. Auf Nachfrage erfahren wir, dass es sich hierbei um den Stoßzahn eines Mammuts handelt, der im 16. Jahrhundert im Tal der Bühler gefunden wurde. Damals wurde dieser Zahn fälschlicherweise als das Horn eines Einhorns gedeutet, worauf auch das ihn umschließende Metallgitter mit den eingearbeiteten Abbildungen hindeutet. Zugegeben ein etwas kurioses Ausstellungsstück in diesem Gotteshaus. Jedoch wurden solche Funde auch gerne als „Wundertaten der Natur“ angesehen und in der Kirche präsentiert, um die Größe der Schöpfung Gottes zu zeigen.
Nachdem wir anschließend die Kirche verlassen hatten, standen wir vor einem Haus, in dem Johann Balthasar Feierabend gewohnt hatte Und mit einem Schmunzeln erzählt uns Frau Däuber, dass es sich hierbei um einen Arzt gehandelt habe, der meistens sehr fröhlich gewesen sein soll. Und als er starb, hat man festgestellt, dass der Wein, der im Keller lagerte, doppelt soviel wert war, wie das ganze Haus. Und es hatte wohl auch einen Stettmeister gegeben, der während des 30jährigen Krieges in den sieben Kellern seines Hauses 2.270 Hektoliter Wein gelagert hatte. Aber all dies deutet nicht darauf hin, dass es sich bei Schwäbisch Hall und seiner Umgebung um eine besonders gute Weinlage handelte. Der Wein, der hier in diesen Mengen gelagert wurde, wurde von den Salzfuhrwerken, die vom Rhein oder vom Neckar zurückkamen, mitgebracht.
Auch die Löwen-Apotheke fand unser Interesse. Sie ist die älteste Apotheke der Stadt und befindet sich in einem spätmittelalterlichen Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert und weist spätmittelalterliche Architekturmerkmale auf. Besonders hervorzuheben ist die historische Apothekenausstattung. Die Apotheke wird, wie wir erfahren, bereits in der 5. Generation geführt.
Dann kamen wir kurz auf die jüdische Gemeinde zu sprechen, denn wir standen vor dem ehemaligen Bethaus von 1883. Aufmerksame Beobachter sahen rechts am Türrahmen eine kleine Kapsel. Wir erfuhren, dass es sich hierbei um eine „Mesusa“ handelt. Sie enthält ein handschriftlich von einem Schriftgelehrten geschriebenes Dokument mit zwei Abschnitten aus dem Glaubensbekenntnis des Judentums. Die Mesusa symbolisiert den Glauben an Gott, erinnert die Bewohner an die Gebote Gottes und soll das Haus und seine Bewohner schützen. Gläubige berühren oder küssen die Mesusa beim Durchschreiten der Türe als Zeichen der Ehrfurcht. Die schräge Anbringung symbolisiert, dass nur Gott vollkommen gerade handeln kann, die Handlungen der Menschen dagegen immer unvollkommen (schief) bleiben.
Schräg gegenüber befindet sich das Haus des Rabbiners. Es wurde 1838 neu erbaut, nachdem das alte Haus zuvor abgebrannt war. Das zweigeschossige, verputzte Gebäude mit klassizistischer Fassadengliederung (Rundbogenportal und Zwerchgiebel) ist ein prägnantes Beispiel klassizistischer Architektur in der Stadt. Wie wir erfuhren, gab es in der Stadt eine kleine jüdische Gemeinde, ca. 1 Prozent der Bevölkerung. Der Rabbiner, Dr. Jakob Berlinger, war ein hochangesehener Mann. Seine Bibliothek umfasste 3.000 Bücher. Und gerade als uns Frau Däuber berichtete, dass damals in der Reichspogromnacht die umfangreiche Bibliothek auf den Marktplatz geschleppt und dort verbrannt wurde, kam just in diesem Moment ein 96jähriger Zeitzeuge vorbei, der dies alles miterlebt hatte und uns kurz seine damaligen Empfindungen schilderte. Ein besonderer und berührender Moment, der noch eine Zeitlang in uns nachklang. Auch weil wir dann noch den Stolperstein sahen, der an Helene Roberg erinnert. Diese war Hausbewohnerin bei dem kinderlosen Rabbiner-Ehepaar und wurde wie eine Tochter behandelt. 1939 floh sie in die Niederlande, wurde jedoch später deportiert und im Vernichtungslager Sobibor in Südpolen ermordet.
Kurzer Halt an der Oberen Herrngasse 7, denn dort hatte das Schild an der Hauswand mit der Aufschrift: „Hier wohnte der Dichter Eduard Mörike mit seiner Schwester Klara 1844“ unsere Aufmerksamkeit geweckt. Wir erfahren, dass es sich jedoch nur um den Zeitraum von etwa einem halben Jahr handelte. Mörike hatte sich von der Haller Sole eine Linderung seiner Leiden (Rheuma und Herzbeschwerden) erhofft. Als dies jedoch nicht eintrat, zog er mit seiner Schwester dann nach Bad Mergentheim. Wie sagte Frau Däuber so treffend: „So hat jedes Haus seine eigene Geschichte!“ Und wir haben viele davon gehört.
Inzwischen können wir auf den Stadtgraben blicken und sehen, dass dieser von Ziegen sauber gehalten wird. Hier sollen wir unsere Blicke auf das große Haus lenken. Es ist der Neubausaal, ein historisches und zugleich multifunktionales Gebäude, das zwischen 1508 und 1527 als Teil der Stadtbefestigung errichtet wurde. Der Neubau diente vor allem als Festsaal der Reichsstadt Hall und auch als Fruchtkasten (Getreidespeicher), in dem die Bauern jährlich ihr Getreide ablieferten. Eine umfassende Renovierung und Modernisierung erfolgte 1978, wobei im Obergeschoss ein moderner Theatersaal mit ca. 640 Sitzplätzen entstand, und im Erdgeschoss ein Mehrzwecksaal mit Platz für ca. 540 Personen geschaffen wurde.
Wir ändern unsere Blickrichtung und schauen nun über den Kocher hinweg auf die Katharinen-Vorstadt, benannt nach der dortigen Kirche. Die Katharinen-Vorstadt in Schwäbisch Hall ist eine historische Stadterweiterung, die im 14. Jahrhundert entstand. Da sich am Ufer des Kochers kaum Flächen zur Ausdehnung befanden, erfolgte die Erweiterung den Hang hinauf, wodurch die Katharinen-Vorstadt als dritte Stadterweiterung entstand. Der Bereich wurde im Mittelalter ummauert, und besonders Handwerker siedelten sich hier an. Noch heute zeugen erhaltene Stadtmauern, beispielsweise am Weilertor, von dieser Phase der Stadterweiterung. Allerdings wurde dieser Stadtteil immer sehr vernachlässigt. Erst vor etwa 40 Jahren hat man begonnen, die Häuser, die zum Teil 600 Jahre alt sind, zu renovieren. Und dann hat Reinhold Würth 2001 in der Katharinen-Vorstadt seine Kunsthalle gebaut, wo wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Würth gezeigt werden. Eine Besonderheit dabei: Der Eintritt ist frei!
„Hermes – der einzige Typ, der es schafft, mit geflügelten Schuhen schneller zu sein als der Paketbote!“. Wieso komme ich jetzt auf „Hermes“? Ganz einfach: In der Unteren Herrngasse 7 muss Hermes wohl einen seiner Flügel verloren haben, denn dort hängt ein Hermes-Flügel quer über der Straße bei der Metallschlosserei Waiditschka. Vielleicht ist der Götterbote dann ja weiter geflogen zu dem großen Wohnturm, der Keckenburg. Erbaut 1239, der steinerne Unterbau stammt aus der Zeit der Staufer und wurde 1515 mit einem Fachwerkaufsatz ergänzt. Die Keckenburg ist Teil eines Gebäudekomplexes, der sieben historische Häuser umfasst. Seit 1955 befindet sich dort das Hällisch-Fränkische Museum, das die Geschichte und Kultur der Region zeigt. Auf zwei besondere Highlights werden wir hingewiesen: Zum einen die bemalte Synagogenvertäfelung, die als europaweit einzigartiges Zeugnis jüdischer Kultur gilt. Das zweite Highlight ist die Sammlung von Kleinplastiken aus Alabaster und Elfenbein von Leonhard Kern, der im 17. Jahrhundert in der Region tätig war.
Und damit waren wir am Kocher angelangt. Dieser floss ruhig dahin und hatte auch nicht sehr viel Wasser. Aber der Blick auf die Hochwassertafel zeigte, wie hoch der Wasserstand am 1. Dezember 1570 war. Es muss laut Frau Däuber ein „ganz grauenvolles Hochwasser“ gewesen sein, ganz nach dem alten Spruch: „Wenn Gott die Menschen will aufwecken, tut er sie mit Feuer und Wasser erschrecken!“
Heute sind wir aber nicht erschrocken, sondern lauschen weiter den kompetenten und oft sehr humorvollen Ausführungen unserer Stadtführerin. Denn nun erzählt sie uns noch einige interessante Details über Schwäbisch Hall und sein Salz. Dabei erfuhren wir dann auch, dass es eine Geldrente für die Nachfahren der damaligen Salzsieder gibt. Nach dem Ende der Reichsstadt Schwäbisch Hall im Jahre 1802 und der Übernahme durch Württemberg übernahm der Staat die Salinenbesitzrechte, und es wurde eine Entschädigung für die Salzsieder vereinbart: Die Nachkommen der ehemaligen Salzsieder erhielten eine „ewige Siedersrente“. Die Betonung liegt hier auf „ewig“. Und diese Rente wird bis heute an rund 300 berechtigte Familien gezahlt, basierend auf einem Vertrag aus dem Jahr 1804, der eine „unveränderliche Jahr-Taxe“ von 480 Gulden zusicherte. Die heutigen Zahlungen summieren sich auf etwa 15.000 Euro jährlich und erfolgen nach einem komplexen Maßeinheitensystem, das aus der alten Salzproduktion stammt. Allerdings können sich die Empfänger davon kein großes Fest oder Essen leisten, so unsere Führerin. Ist auch nachzuvollziehen, denn die Gesamtsumme von ca. 15.000 Euro jährlich geteilt durch 300 Familien ergibt durchschnittlich etwa 50 Euro pro Jahr und Berechtigten, das entspricht ungefähr 4 bis 5 Euro monatlich pro Familie. Und mit dieser Erkenntnis waren wir am Schluss unseres Rundgangs angekommen. Es ging jetzt noch über den Roten Steg, wo wir auf der anderen Seite wieder auf unsere andere Gruppe stießen. Noch schnell ein Gruppenfoto und ein herzlicher Dank an die beiden Damen, die uns so kompetent und humorvoll Schwäbisch Hall und seine Geschichte nähergebracht haben.
Im Sudhaus wurden wir schon erwartet. Eine nette Geste war das Schild am Eingang, was uns auch gleich aufzeigte, dass unsere Plätze im 1. OG reserviert waren. Aufgrund der telefonischen Vorbestellung ging es dann auch sehr zügig, und Getränke und Speisen wurden rasch serviert. Schnell entstand wieder eine rege Unterhaltung. Wobei die Themen sowohl das frühere Miteinander wie auch das heute Erlebte betrafen. Doch bald stand auch die Frage im Raum: Und was machen wir nach dem Essen? Denn der weitere Nachmittag war ja zur freien Verfügung. Für die Einen stand der Besuch eines Cafés noch an, evtl. auch ein weiterer individueller Bummel durch die Stadt oder aber ein Besuch in der Kunsthalle Würth oder in der Johanniterkirche, wo Würth eine Ausstellung präsentiert mit dem Titel „Alte Meister“. Auch hier ist der Eintritt frei, und sehr zu empfehlen.
Das Highlight dieser Ausstellung ist die berühmte „Schutzmantel-Madonna“ von Hans Holbein dem Jüngeren. Die Schutzmantel-Madonna gilt als Durchbruch Holbeins in die Renaissance-Malerei und wird kunsthistorisch oft mit der Sixtinischen Madonna von Raffael verglichen. Aber auch alle anderen präsentierten Werke sind beeindruckend. Und toll fanden wir es auch, dass die Besucher die Werke fotografieren dürfen. Ehrlich gesagt, war die Zeit dann fast zu knapp, um alle Ausstellungsstücke in aller Ruhe zu betrachten. Denn auch der Falkensteiner Altar vom Meister von Meßkirch oder die Werke von Tilman Riemenschneider und Lucas Cranach dem Älteren ziehen einen in ihren Bann. Aber schließlich ist Schwäbisch Hall ja nicht so weit weg, und bei freiem Eintritt lohnt sich ein weiterer Besuch auf jeden Fall.
Beim weiteren kurzen Bummel durch die schöne Stadt ließ Petrus dann doch noch ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Vielleicht wollte er einfach sicher gehen, dass wir keine Spuren vom Salz mit nach Hause nehmen. Aber was machten die paar Spritzer denn schon aus, wo wir doch so einen tollen Tag erleben durften. Doch wie heißt es: „Wenn’s am Schönsten ist…“. Denn für uns war es jetzt Zeit, dass wir uns alle wieder am Busbahnhof trafen, um die Heimfahrt anzutreten. Auch diese verlief gut und ohne Staus, und im Bus gab’s viel zu erzählen, was wir alles gesehen, gehört und erlebt hatten. Wir alle waren uns einig darüber, dass auch dieses ASP-Event wieder ganz toll war, und wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei Anne Tschürtz und Gabi Ivenz für die gute Organisation und reibungslose Durchführung. Dieser Rundgang durch Schwäbisch Hall mit seiner einzigartigen Mischung aus mittelalterlichen Fachwerkhäusern, lebendiger Kulturgeschichte, dem bedeutenden jüdischen Erbe und der beeindruckenden Kirchenkunst, ließ uns die Geschichte der Stadt auf Schritt und Tritt erleben. Ein sehr interessanter, abwechslungsreicher Tag, der noch lange in uns nachklingen wird. Und mit diesem guten Gefühl freuen wir uns schon jetzt auf die nächste Veranstaltung unseres ASP, denn:
„Mit unserm ASP isch’s halt immer schee!“
Horst Neidhart
Fotos: Petra Benub, Horst Neidhart
Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither
Bericht kommt noch
Fotos: Thomas Elm, Rolf Omasreither
Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither
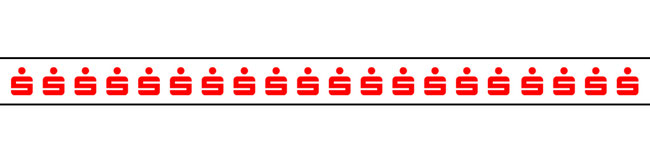

„Gäwele sitzt uff’m Bänkle, schaut naus ins weite Land,
mit’m Schmunzle auf de Lippe, und’m Viertele in dr Hand.
Er sagt: „Des Leba isch a G’schenk, solang mer lacht und trinkt“,
so heißt es in einem Gedicht über das Gäwele in einer der Geschichten des Hohenloher Autors Wilhelm Schrader. Und wenn wir das Gäwele auch nicht persönlich angetroffen haben, so wurde uns doch dessen Philosophie von einem echten Hohenloher Winzer beweiskräftig nähergebracht. Doch dazu später mehr, denn bis wir „uff’m Bänkle“ sitzen durften, dauerte es schon noch eine Weile.
Treffpunkt: 9.00 Uhr Bahnhofsvorplatz Ludwigsburg, so stand es in der Email von unserem ehemaligen Kollegen, Uli Bertsch, der für uns diese ASP-Wanderung am 5. Juni 2025 organisiert hatte. Und es dauerte auch nicht lange, da hatten sich 28 ehemalige Kolleginnen und Kollegen genau dort getroffen und sich über das Wiedersehen sichtlich gefreut.
Uli Bertsch begrüßte uns alle sehr herzlich und gab uns einen kurzen Überblick über den geplanten Verlauf der heutigen Wanderung auf dem Eselspfad von Öhringen nach Waldenburg. Und wie er uns versicherte, hätte er mit dem Wettergott rechtzeitig eine Absprache getroffen, dass es heute trotz mancher dunklen Wolken am Himmel keinen Regen geben sollte. Danke Uli, das hast Du prima hingekriegt!
Um 9.21 Uhr hieß es dann Einstieg in den Zug nach Heilbronn, und dort dann Umstieg und Weiterfahrt nach Öhringen, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung. Nach gut einer Stunde sind wir dort auch angekommen. Wie immer entstand schon während der Zugfahrt eine rege Unterhaltung, denn oftmals gab es ja viel zu erzählen, über Aktuelles, aber auch über Vergangenes aus unserer gemeinsamen Zeit bei unserer Sparkasse. Jetzt in Öhringen angekommen, stieg natürlich die Neugierde bei allen Teilnehmenden auf das, was uns während der Wanderung erwarten würde.

Noch ein kurzer Hinweis auf den Eselspfad und seine historische Bedeutung. Denn der Eselspfad diente speziell als Salzweg zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen. Salz war im Mittelalter bekanntermaßen ein wertvolles Handelsgut. Und der Eselspfad verband wichtige Städte und führte durch Regionen mit mittelalterlichen Siedlungen und Burgen, was die strategische und wirtschaftliche Rolle des Weges in der Region Hohenlohe verdeutlicht. Und damit ist der Eselspfad auch heute noch ein eindrucksvolles Zeugnis mittelalterlicher Verkehrs- und Wirtschaftsgeschichte in Süddeutschland.

Dann marschierten wir auch schon zügig auf der Bahnhofstraße entlang und stutzten, als wir den Mann sahen, der in der einen Hand seinen Regenschirm, und in der anderen Hand eine Gießkanne hielt, aus der Wasser spritzte. Und wenn jetzt eine(r) von uns dachte: „Ha, so an Hamballe, was gießt denn der, wenn’s sowieso regnet?“, dann war dieser Gedanke ein Volltreffer. Denn bei dem Mann mit Regenschirm und Gießkanne handelt es sich tatsächlich um den „Hamballe“, eine Brunnenfigur, die 1986 aufgestellt wurde. Die Skulptur ist ein humorvolles, künstlerisches Wahrzeichen der Stadt und steht exemplarisch für den schwäbische Witz und die Liebe zur Gartenkultur, die Öhringen prägen. Eine Kultfigur der Stadt für einen liebenswerten, etwas tölpelhaften Menschen, ähnlich dem schwäbischen „Huatsempl“ oder „Lellabebbl“.

Weiter ging es nun an der Stiftskirche vorbei zum historischen Marktplatz. Die Umgebung des Marktplatzes ist geprägt von Fachwerkhäusern aus verschiedenen Epochen, barocken Gebäuden und dem Hohenloher Residenzschloss. Ins Auge fiel uns aber auch der stattliche Zunftbaum vor dem Rathaus. Dann stehen wir auf der prächtigen Schlosstreppe, die hinunter zum barocken Hofgarten führt. Dieser wurde um 1713 im französischen Stil angelegt und um englische Elemente ergänzt. Heute dient der Park den Bürgern von Öhringen als grüne Oase. Wir bleiben kurz auf der Treppe stehen, denn dies ist ein idealer Platz für ein Gruppenfoto. Unten am Park angekommen, wird auch noch das eine oder andere Handy gezückt, um diesen schönen Park im Bild festzuhalten.
Doch mit der Idylle ist es ganz schnell vorbei. Gerade als wir eine Verkehrsstraße überqueren wollten, hieß es abrupt stehen zu bleiben, denn mit lautem „Tatütata“ brauste ein Feuerwehrauto an uns vorbei.

Danach zieht der Kletterturm von Öhringen unsere Blicke auf sich. Hier bietet die Stadt ein vielseitiges und modernes Freizeitangebot für die ganze Familie. Sportliche Herausforderung, Spaß und ein toller Ausblick von der Aussichtsplattform in 15 Metern Höhe sind geboten. Doch unsere sportliche Herausforderung geht ja erst richtig los und deshalb wandern wir mit flotten Schritten weiter. Der nächste Turm, den wir in einiger Entfernung sehen können, ist der Wasserturm am Buchhorner See. Doch dann sollten wir unsere Blicke besser nach unten richten, denn jetzt heißt es gut auf den Weg zu achten. Der Pfad durch das Waldstück ist sehr schmal, Gänsemarsch ist angesagt. Aber es macht sichtlich Spaß. Doch bald haben wir wieder freie Fläche erreicht und können unsere Blicke über die herrliche Landschaft schweifen lassen.

Es dauert nicht mehr lange, und wir haben den Ortsrand von Oberohrn erreicht. Auch hier wieder ein nettes Fotomotiv: der alte Dorfbrunnen treibt ein Löffelrad an. Doch dann geht’s flott wieder weiter, immer der Wegmarkierung mit der roten Traube folgend. Die am Wiesenhang grasenden Pferde lassen sich von unserer Gruppe nicht stören. Im Gegensatz zu uns, sind sie schon am „futtern“. Doch halt, was ist das? Kollege Eberhard Haug hat am Rande des Weges einen Kirschbaum entdeckt, der schon etliche dunkelrote Früchte hat. Eine kleine Kostprobe ist da natürlich angesagt, und ganz Kavalier lässt er auch Roswitha Münder davon kosten. Na ja, ganz so süß waren die Früchte dann wohl doch noch nicht. Aber einen Versuch wars ja wert.
Nach Wald- und Wiesenlandschaften sind wir jetzt in den Weinbergen angekommen. Hier gilt unser Augenmerk zunächst den leuchtend schönen Rosenstöcken, um sich kurz danach am Blick auf die Hohenloher Landschaft zu erfreuen. Jetzt ist ein kurzer Stop angesagt. Uli Bertsch erkundigt sich, ob wir alle noch fit sind, denn inzwischen sind wir ja schon ca. 2 Stunden unterwegs. Dann verspricht er uns eine Überraschung. Dazu müssten wir jetzt aber am Hang des Weinbergs nach oben steigen.
Also auf geht’s! Was das wohl für eine Überraschung sein wird? Bereits nach wenigen Minuten wissen wir es: Wir sind an einer tollen Hütte angekommen, wo uns Sitzbänke zum Verweilen einladen. Doch nicht nur die Sitzbänke sind die versprochene Überraschung, sondern das, was uns direkt daneben angeboten wird: Wir können es kaum glauben, was wir da sehen: eine Vielzahl von diversen Weinen der Weinkellerei Hohenlohe und der Marke FÜRSTENFASS. Weiss, Rot oder Rosé. Egal ob Sauvignon Blanc, Muskattrollinger Rosé, Weissburgunder Halbtrocken, Riesling mit Muskateller, Chardonay, Merlot im Holzfass gereift, Lemberger Kabinett oder auch Securus Rosé alkoholfrei. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Ausschank-Hütte dazu passend als „Vesper-Happen“: -Brezeln mit und ohne Butter, Hefezopf „mit und ohne“, und eine große Auswahl an Obst und an Gemüse-Sticks. Wir stehen zunächst nur da und staunen. Dann stellt uns Uli Bertsch Herrn Jens Breuninger vor, den Eigentümer dieser Hütte und des umgebenden Weinbergs. Und für die tolle „Vesper-Auswahl“ hat Svenja Bertsch gesorgt, die Tochter unseres Kollegen, die mit ihren beiden Kindern auch hier ist und alles schön dekorativ aufbereitet hat.
Ja und dann haben wir es genauso gemacht, wie ich es vom Gäwele ja eingangs beschrieben habe: „Mir sitzet uff’m Bänkle, schauet naus ins weite Land, mit’m Schmunzle auf de Lippe, und’m Viertele in dr Hand.“ Und Jens Breuninger und Svenja Bertsch freuten sich, als sie sahen, wie wir immer wieder beherzt zugriffen und uns Wein und Vesper munden ließen. Gerne gab uns Herr Breuninger auf Nachfrage zu den einzelnen Weinen auch noch nähere Auskünfte. Schließlich ist er ja nicht nur Winzer aus Leidenschaft, sondern auch für den Weinbauverband Württemberg tätig. Dort ist er bereits seit 2014 Leiter der Landesweinprämierung.
Dann informierte er uns noch kurz über die Hohenloher Weinkellerei, die 1950 gegründet wurde und insgesamt eine Fläche von ca. 560 ha durch knapp 500 Winzerfamilien bewirtschaftet. Anschließend lenkt er unsere Blicke auf das weite Panorama der Waldenburger Berge und deren Höhenzüge wie den Ferrenberg, Goldberg und Lindelberg.
Und wir erfahren, dass man von hier oben aus bei guter Sicht sogar den Katzenbuckel im Odenwald sehen kann. Schauen wir dagegen nach unten, fällt unser Blick auf Michelbach am Wald und die weite und offene Landschaft, die den Ort umgibt. Und wir können verstehen, weshalb die Hohenloher so stolz auf ihre Landschaft sind.

Nachdem ja auf allen Weingläsern das Gäwele zu sehen ist, erzählte er uns dann auch noch kurz etwas zu dieser Hohenloher Kultfigur, in dessen Rucksack ja immer genügend Platz war, um darin etwas zu verstauen, bzw. zu verstecken. Demnach hat Gäwele einen Auerhahn darin so geschickt versteckt, dass ihn der Förster trotz Nachschauens nicht finden konnte. Genügend Platz war aber auch in der – an der Theke bereit gelegten - Sammelschale-, in die wir alle sehr gerne unsere Spenden hineinlegten für die genossenen Weine und das Vesper, oder auch für das eine oder andere zur Erinnerung eingepackte Gäwele-Glas
Doch nun war es wieder Zeit zum Aufbruch. Denn wie heißt es in einem alten, uns allen bekanntem Sprichwort so treffend: „Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist!“ Ja, wir waren uns alle einig: es war wirklich sehr schön Und ich übertreibe daher nicht, wenn ich sage, wir haben es im wahrsten Sinn des Wortes genossen, sowohl die vorzüglichen Weine wie das schmackhafte, diverse Vesper, aber auch die tolle Aussicht. Ganz im Hohenloher Dialekt gesprochen sage ich daher für uns alle:
„Vergelt’s Gott fir de guade Woi ond s’Vesper! Des war richtig schee!“
Nun aber war es wirklich wieder an der Zeit aufzubrechen. Denn schließlich wartete ja in Waldenburg im Restaurant Bergfried auch noch das Mittagessen auf uns. Doch dafür mussten wir jetzt erst einmal wieder unsere Rucksäcke aufnehmen und weitermarschieren. Unser Wanderführer, Uli Bertsch, gab uns noch einige Hinweise über den weiteren Verlauf der Wanderstrecke, und dass wir dabei auch noch auf Spuren der Römer stoßen würden. Und wenn jetzt auch vereinzelt mal zu hören war: "D’Fiaß send jetz aber scho a bissle schwer worda" ging es letztlich doch flotten Schrittes weiter. Nach dem Weinberg erwartete uns jetzt wieder der Wald mit teilweise schmalen Pfaden. Es war dieser ständige Wechsel des Wegverlaufes zwischen offenen Landschaften mit Wiesen und Obstanlagen, dann durch Hohlwege, danach über Höhenrücken oder Hügel und wieder durch idyllische Waldabschnitte, der diesen Weg für uns so interessant machte und uns einfach Freude bereitete.
Und nach ca. einer ¾ Stunde kreuzte unser Pfad den Römerweg. Dieser ist ein lebendiges Zeugnis jahrtausendealter Mobilität und Handelsgeschichte. Seine Wurzeln reichen bis in die keltische und römische Zeit zurück. Dessen muss man sich einfach bewusst werden, wenn man auf diesen Steinen steht, mit denen damals dieser Weg gepflastert wurde.

Nach weiteren 25 Minuten haben wir das Ortsschild von Waldenburg erreicht. Doch wir sind noch nicht am Ziel, es liegt nochmal in etwa die gleiche Weglänge vor uns. Halt! Was ist das denn? Rechts am Wegrand ein „Body-Scanner“. Was damit gemeint ist, wird einem schnell klar, sobald man versucht durch den Baumstamm hindurch zu gehen. Denn dies ist nur mit seitlicher Körperdrehung möglich. Hat man dies - wie unsere Kollegin Roswitha Münder -geschafft, ist einem der Durchblick sicher und bestimmt auch ein Foto zur Erinnerung.
Und für alle, die dies mit dem Durchblick nicht geschafft (oder auch nicht „gerafft“ haben), gibt es ab hier zur Entschädigung wieder tolle Weitblicke in die schöne Hohenloher Ebene. Danach kommen wir am Albert-Schweitzer-Kinderdorf vorbei, welches in herrlicher, naturnaher Lage am Waldrand liegt und auf seinem 2,5 Hektar großem Gelände von Wiesen umgeben ist.
Doch dann haben wir schon die Stadtmauer von Waldenburg erreicht und erfreuen uns an dem schönen Blumenschmuck am Fuß der Mauer. Und alle, die jetzt nicht nach oben zur Spitze des Lachnersturmes blicken, sondern nach unten auf den gepflasterten Weg schauen, die sehen jetzt dieses schöne Mosaik direkt am Eingang des Turmes.

Das Mosaik zeigt zwei Frauen in traditioneller Kleidung, die Wasserkrüge und Eimer tragen. Im Hintergrund sind Treppen, eine Stadtmauer und stilisierte Gebäude zu erkennen, was auf die Altstadt von Waldenburg verweist. Die Szene spielt auf die historische Bedeutung der Wasserversorgung in Waldenburg an: Früher mussten die Frauen das Wasser von Brunnen im Tal mühsam den Berg hinauf in die Stadt tragen, da es keine moderne Wasserleitung gab. Diese Aufgabe war alltäglich, aber körperlich sehr anstrengend und von zentraler Bedeutung für das Leben in der Stadt. Das Mosaik würdigt damit die Arbeit und die Rolle der Frauen in der Geschichte Waldenburgs und macht auf die einstige Herausforderung der Wasserversorgung aufmerksam.
Direkt neben dem Turm steht das Hotel und Restaurant „Bergfried“, wo wir schon erwartet wurden. Nun ging alles relativ rasch. Kaum hatten wir Platz genommen, standen auch schon die bestellten Getränke auf den Tischen und wenige Minuten später wurden dann auch schon die bestellten Speisen serviert. Und so gut wie der Service war, so gut war auch das Essen. Und so genossen wir diesen tollen Dreiklang: Speisen, Unterhaltung und den schönen Ausblick. Apropos Ausblick: Und wer jetzt noch Lust hatte, konnte sich zusätzlich auch noch einen tollen Panoramablick verschaffen, denn Uli Bertsch hatte sich für uns den Schlüssel für den Lachnersturm beschafft.

Der Lachnersturm ist der höchste Aussichtsturm Hohenlohes und stammt aus dem Mittelalter. Er war einst Teil der Stadtbefestigung von Waldenburg. Im Inneren führen 110 enge Treppenstufen nach oben. Zugegeben etwas mühsam, aber machbar und lohnenswert. Denn oben angekommen schweift der Blick weit über die Hohenloher Ebene, die Waldenburger Berge und über das Ensemble der Altstadt. Die exponierte Lage auf einem Bergrücken, auch „Balkon Hohenlohes“ genannt, machen ihn damit zu einem der schönsten Aussichtspunkte dieser Region.
Mit so vielen schönen Eindrücken versehen, gut gespeist und den Flüssigkeitshaushalt des Körpers wieder aufgefüllt, standen für uns jetzt nur noch Bus- und Bahnfahrt auf dem Programm. Mit dem Bus vom Restaurant direkt zum Bahnhof. Von dort dann noch ca. 1 ¼ Stunden Bahnfahrt bis Ludwigsburg mit Umstieg in Heilbronn und Ausstiegsmöglichkeit in Bietigheim. Während der Zugfahrt wurde sich intensiv über alles Erlebte und den tollen Wandertag unterhalten. Diese großartige Wanderung auf dem Eselspfad von Öhringen nach Waldenburg war ein durchaus sportliches Abenteuer, das uns jedoch nicht nur gefordert, sondern auch mit vielen Höhepunkten belohnt hat. Es war diese doch sehr abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die durch jahrhundertelange menschliche Nutzung geprägt ist. Und es waren die sich von den Höhenrücken bietenden weiten Ausblicke, die das Gefühl von Freiheit und offener Ferne vermittelten. Und ein echtes Highlight war die Überraschung auf der Hütte von Jens Breuninger mit den vielen angebotenen Weinen und dem leckeren Vesper, welches uns Svenja Bertsch angerichtet hatte. Das hat diese Wanderung perfekt abgerundet und für eine tolle Stimmung in der Gruppe gesorgt, was auch nochmal beim Abschluss im schönen Restaurant Bergfried spürbar war. Und so gilt unser aller herzlicher Dank dem Kollegen Uli Bertsch für die hervorragende Organisation und Durchführung dieses wieder tollen ASP-Events. Und nochmal mit dem Hohenloher Dialekt betont:
„Des war richtig schee! Mit Uli Bertsch und dem ASP!“
Horst Neidhart
Fotos: Horst Neidhart
Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither

Die Fessler Mühle gilt als Schmuckstück der Region, eine historisch-traditionelle Besonderheit mit modernem Betrieb.
Die gesamte Anlage besteht aus Mühle, Mühlenladen, Museum, Sportinstitut, Kleinkunstbühne, Seminarküche, Bäckerei, Destillerie und dem historisches Backhaus mit Holzbackofen.
Man betritt ein wunderschönes Fleckchen Erde, eine andere Welt.
Die 24 aktiven Sparkassenpensionäre wurden am 14.5.2025 herzlich von Familie Fessler begrüßt. Es erfolgte eine kurze Erklärung des Tagesablaufs und die Aufteilung in die Gruppen Tasting und Brotbacken.
Tasting (Verkostung)
Die 11 ASP-ler der Tasting-Gruppe wurde von Tobias Fessler ins Dachgeschoss der Kleinkunstbühne, in einen urig eingerichteten Raum, geführt.
Dort waren 3 Whiskys, 1 Rum und 1 Gin bereitgestellt. Diese wurden im Laufe des Nachmittags verkostet.
Der Tisch war mit Nosinggläsern, speziellen Verkostungsgläsern eingedeckt.
Tobias Fessler, einer der Masterdestiller, erklärte: Beim Tasting, also der Verkostung von Getränken, werden Nase, Mund und Abgang gezielt beurteilt. Die Nase dient der Geruchswahrnehmung, im Mund werden die Aromen und Geschmacksrichtungen genau analysiert, und der Abgang zeigt, wie lange der Geschmack nachwirkt.
Die „Mettermalt Whiskys“ gibt es in 3 Varianten, single malt, single cask und Sondereditionen.
Im April 2023 gab es eine besondere Veröffentlichung:
die Whisky Edition „VfB Stuttgart“, das Zauberwasser aus Sersheim.
Die Spieler des VfB haben sich in der Saison 2023/2024 von Platz 16 zum Platz 2 hochgespielt. Eventuell hat da, neben Fleiß und einem engagierten Trainer, auch noch was Anderes geholfen. Denn damals wurden bei Fessler
1893 Flaschen mit dem VFB Stuttgart Sonderetikett abgefüllt. Neben den Fans haben sicher auch die Spieler von diesem Zauberwasser genascht, und es hat ja offensichtlich auch gewirkt.
Bei der Besichtigung der Destillerie wurde detailliert erklärt, wie ein guter Gin entsteht. Hier handelt sich um einen London Dry Gin, die höchste Qualitätsstufe. Da der Begriff „London“ doch eher irreführend ist, wird hier von „Swabian dry Gin“ gesprochen. Auch dieser Gin wird aus regionalen Produkten hergestellt, die in der Regel selbst angebaut werden.
Beim Rum handelt es sich um einen komplett natürlichen Rum. Da der Zuckerrohranbau in Deutschland noch nicht sehr verbreitet ist, wird hier mit Zuckerrohrsaft aus Mauritius gearbeitet.
Im Anschluss an die Probe durfte noch das Warehouse besichtigt werden. Hier lagern einige Sondereditionen und eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Fässer, in denen auch die Einzelfassabfüllungen reifen dürfen.
Brotbacken
Frau Nadine Wanitzek übernahm die 13 ASP-ler, die sich fürs Brotbacken angemeldet haben, und führte diese hoch in die Brotbackstube. Zu Beginn erklärte sie ausführlich, was Mann bzw. Frau übers Brotbacken wissen sollte.
Um Brot zu backen, braucht man im Prinzip nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe, die als erstes zu einem Vorteig vermischt werden. Eine besondere Form des Vorteiges ist dabei der Sauerteig. Hierbei werden dem Vorteig spezielle Milchsäurebakterien zugesetzt, die den Teig sauer werden lassen und hierbei lockern.
Um Brote zu verfeinern, lassen sich Samen und Körner gut in den Teig einarbeiten. Beliebt sind unter anderem, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Hanfsamen und Mohn. Auch Haferflocken, Mandeln und Walnüsse können dem Teig hinzugefügt werden.
Jetzt erklärte Frau Wanitzek noch Wissenswertes über die verschiedenen Mehlsorten, von denen sie sechs für uns bereitgestellt hatte.
Die Theorie war nun vorbei und zur ersten Handlung gehörte das Waschen der Hände.
Im Mischungsverhältnis von 600 gr. Weizenmehl und 150 gr. eines der anderen Mehle musste jeder seine individuelle Mischung abwiegen und anschließend Hefe, Salz und Wasser und eventuell auch noch Samen und Körner hinzufügen.
Eifrig begannen wir nun mit dem Vermischen der Zutaten, bis ein zufriedenstellender Brotrohling fertig war.
Jetzt war Warten angesagt, denn der Teig musste gehen. Auch wir durften gehen und schlenderten durch das Betriebsgelände, besuchten den Mühlenladen oder unterhielten uns, bis die ausgemachte Zeit uns wieder in die Backstube zurückführte.
Jeder kratzte jetzt seinen Teigrohling aus der Plastikschüssel und knetete diesen, unter den prüfenden Augen von Frau Wanitzek, mit vollem Engagement zu einem gelungenen Brotteig, der nun in einen traditionell geflochtenen Bastkorb, auch Gärkorb genannt, gelegt wurde.
Während der Teig nun weiter gehen musste, erhielten wir eine Broschüre mit vielen Brot-Rezepten, die wir mit Hilfe von Frau Wanitzek in aller Ruhe durchgehen konnten.
Bei Interesse können Sie diese Broschüre in Form einer Word-Datei am Ende der Ausführungen herunterladen.
Mit leichtem Stolz haben wir nun unsere „Kunstwerke im Gärkorb“ eine Etage tiefer zum Backhaus getragen, wo sie von Frau Wanitzek liebevoll bezeichnet und auf ein großes Backblech gelegt wurden. Mit der tatkräftigen Hilfe eines ASP-lers wurden die Brote nun in eine der Etagen des großen, vorgewärmten Ofens geschoben und unsere Arbeit war damit zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle unseren beiden fachkundigen „Ausbildern“, Frau Nadine Wanitzek und Herrn Tobias Fessler, aussprechen. Sie haben uns praktikable und wissenswerte Erfahrungen geschenkt!
Nach ca. zwei, sehr interessanten und informativen, Stunden trafen sich die zwei Gruppen im Theater-Restaurant zum gemeinsamen Vesper, zum Schwätzen, Lachen und gemütlichen Beisammensein.
Jetzt fehlte nur noch der Höhepunkt der Brotbäcker. Das Brot ist fertig! Hieß es. Eilig rannten wir zur Backstube, wo Frau Fessler die noch heißen Brote verteilte.
An den strahlenden Gesichtern der 13 Neu-Bäcker/innen war die Begeisterung abzulesen. Alle Brote waren gelungen und dufteten herrlich.
Wieder einmal ging damit ein ausgezeichnetes ASP-Treffen zu Ende.
Doch nicht zuletzt möchten wir uns bei Regine Jung für ihre Idee und die Durchführung dieser prima Veranstaltung bedanken und freuen uns schon auf das nächste ASP- Event.

Schön, dass Sie heute hier sind…
…so war auf den kleinen Tütchen am Empfang im Mercedes-Benz-Kundencenter Sindelfingen zu lesen. Doch soweit sind wir ja noch gar nicht, denn am Dienstag, den 29. April 2025, trafen wir uns erst einmal ab 09:45 Uhr am Vorplatz vom Bahnhof Ludwigsburg. Wir, das waren 43 ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die heute alle Eines einte: die Freude über das Wiedersehen und die Neugierde, was uns beim heutigen Event - einer Werksführung bei Daimler-Benz in Sindelfingen - erwarten würde. Unsere beiden Kolleginnen vom ASP, Sonja Ehnle und Herta Stahl, freuten sich über die große Zahl der Anmeldungen, was ja wieder einmal mehr beweist, wie beliebt die Veranstaltungen unseres ASP bei uns Ehemaligen sind. Und dann konnten wir feststellen, dass mit dem Begriff „Zetteleswirtschaft“ nicht immer etwas Negatives verbunden sein muss. Nein, im Gegenteil, hier erfüllten die „Zettela“ einen sinnvollen Zweck: Denn alle Teilnehmenden erhielten ein kleines Zettele, auf dem aufgedruckt war, welches Gericht man im Vorfeld zum Mittagessen vorbestellt hatte.
Danach begrüßte uns Sonja Ehnle alle sehr herzlich und gab uns einen kurzen Überblick über den vorgesehenen Ablauf des heutigen Tages. Um 10:16 Uhr hieß es dann einsteigen in die S5 und später in Stuttgart umsteigen in die S1 nach Böblingen. Vom dortigen ZOB waren es nur wenige Schritte bis zum IL-Fresco, einem schönen Restaurant mit italienischem Ambiente, wo wir unser Mittagessen einnahmen. An den Tischen entspann sich ganz schnell eine muntere und fröhliche Unterhaltung und alle freuten sich schon darauf, mal wieder italienische Küche zu genießen. Um es kurz zu machen: wir wurden nicht enttäuscht. Die bestellten Gerichte wurden rasch serviert, waren für das Auge sehr ansprechend angerichtet und schmeckten uns allen sehr gut. So gestärkt konnte es dann wieder weitergehen. Nein, eigentlich müsste es heißen weiterfahren. Denn nun warteten wir auf den Shuttle-Bus von Daimler, der uns zum Werksgelände und Kundencenter von Daimler-Benz bringen sollte.
Nach kurzem Warten kam dieser auch angerollt und wir stiegen ein, wobei unsere Spannung schon spürbar immer weiter stieg. Nach kurzer Fahrt waren wir beim Kundencenter angekommen, erkennbar an dem großen Mercedes-Stern vor dem Eingang. Dort hatten wir zunächst einmal etwas Zeit, um uns in dieser hellen und großen Empfangshalle etwas umzusehen und auch einige der dort ausgestellten Mercedes-Fahrzeuge zu besichtigen. Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass insbesondere ein Fahrzeug unsere Blicke auf sich zog, denn so oft hatten wir das ja bestimmt auch noch nicht gesehen, wenn denn überhaupt. Es war ein Maybach 62 S Landaulet. Ein Auto der obersten Luxusklasse, eines von nur 21 gebauten Fahrzeugen! Und wann hatte jemals eine oder einer von uns die Gelegenheit, in so einem luxuriösen Fahrzeug im Fond oder gar hinter dem Lenkrad Platz zu nehmen? Heute gab es diese Chance – und manche nutzen sie auch! Jedoch auch das erste dreirädrige „Auto“ von Benz auf der anderen Seite der Halle faszinierte uns. Und bei dieser Betrachtung wurde uns deutlich bewusst, welche revolutionäre und innovative Entwicklung das Automobil in diesen Jahren seit 1885 bis heute genommen hat.
Doch dann war Schluss mit Staunen und Probesitzen. Jetzt galt es die Gruppe aufzuteilen, da pro Führung maximal 30 Teilnehmer möglich waren. Dies ging sehr zügig, getreu dem Motto: „Gohsch Du mit dene, na gang i do au mit!“. Danach stellten sich unsere beiden Guides vor: Frau Jessica Deutsch und Herr Lorenzo Santaniello. Ich gehörte zur Gruppe mit diesem Führer. Herr Santaniello hieß uns hier bei Daimler-Benz im Kundencenter herzlich willkommen und ermunterte uns gleich zu Beginn, gerne auch während seiner späteren Ausführungen Fragen zu stellen. Wie es sich zeigte, hatten wir viele Fragen während der folgenden, sehr interessanten Führung. Und dies sei hier gleich vorweg betont, alle unsere Fragen wurden immer gerne und kompetent von ihm beantwortet.
Sein Vorschlag war nun, dass wir uns zunächst einen kurzen Film im Kinosaal ansehen, um einen ersten Überblick über das Werk Sindelfingen zu erhalten. Danach würden wir dann mit einem Bus durch das Werksgelände zum Presswerk fahren und nach dessen Besichtigung weiter zu einer der Montagehallen. So nahmen wir denn erst einmal im Kinosaal Platz, um uns einen etwa 6-minütigen Imagefilm anzuschauen. Vorher gab uns jedoch Herr Santaniello noch eine kurze Einführung. Auf der großen Leinwand sahen wir zunächst Bilder vom Kundencenter, wo Kunden ihren Mercedes in Empfang nehmen können. Und wir erfahren, dass der Kunde grundsätzlich zwei Möglichkeiten hat: entweder sein neues Auto in einer Niederlassung oder aber in einem der drei Kundencenter abzuholen. Diese gibt es neben Sindelfingen auch noch in Rastatt und in Bremen, wo die vollelektronische Business Limousine EQE hergestellt wird. Und wir hören, dass das Kundencenter auch für Veranstaltungen und Seminare gebucht werden kann.
Eine Luftaufnahme zeigt uns dann die enorme Größe des Werkes hier in Sindelfingen. Und es klingt schon etwas Stolz mit, als uns gesagt wird, dass dies tatsächlich das größte Werk in Europa und eines der größten Werke weltweit ist, wenn man die Motorenwerke in Stuttgart-Untertürkheim mit einbezieht. Wobei allein in Untertürkheim, wo Motoren und Antriebstechniken entwickelt und gebaut werden, ca. 15.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Werk hier in Sindelfingen hat die immense Größe von rund 3 Quadratkilometer und beschäftigt rund 35.000 Mitarbeiter.
Davon sind laut Herrn Santaniello allein im MTC, dem Mercedes-Benz Technology Center, rund 10.000 Mitarbeiter, zumeist Ingenieure und Designer, tätig. In diesem Center sind Forschung, Entwicklung und Design angesiedelt. Und er betont, dass jeder Mercedes, egal wo er später gebaut wird, hier im MTC Sindelfingen entwickelt wurde.
Wir erfahren dann, dass es hier innerhalb des Werkgeländes 2 Teststrecken gibt. Eine mit 3 km Länge und die andere mit 2 km Länge. Jeden Tag werden hier Dutzende von Fahrzeugen getestet. Sowohl Fahrzeuge, die noch gar nicht auf dem Markt sind, aber stichprobenweise auch Fahrzeuge, die später an den Kunden übergeben werden.
Dann stellt Herr Santaniello die Frage: „Was benötigen wir, wenn wir einen Mercedes bauen möchten?“ Und er sagt uns, dass dies quasi in 4 Schritten erfolgt: Es beginnt mit den entsprechenden Teilen der Karosserie wie Türen, Motorhaube oder auch Kofferraumdeckel. Diese Teile werden im Presswerk – welches wir später besichtigen werden – gefertigt. Der nächste Schritt ist der Zusammenbau der Rohkarosse. Hier im Rohbau werden die Einzelteile mit verschiedenen Fügetechniken zusammengefügt. Eine Tätigkeit, die zu fast 100% von Robotern ausgeführt wird. Ist die Rohkarosse fertig, kann mit der Lackierung als nächster Schritt begonnen werden. Auch hier sind sehr viele Roboter und nur wenige Mitarbeiter im Einsatz, denn es besteht eine hohe Automatisierungsquote.
Es folgt dann noch der Hinweis auf die Fa. Dürr aus Bietigheim-Bissingen, die hier eine große Rolle spielt. Dürr und Mercedes-Benz haben eine langfristig angelegte strategische Partnerschaft im Bereich Lackiertechnik-Anlagen geschlossen mit dem Ziel, die Fahrzeuglackierung CO2-frei zu machen und damit gemeinsam neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit zu setzen. Dabei ist es Ziel, den Energieverbrauch pro lackierter Karosserie um ca. 50% zu reduzieren.
Nun muss das Fahrzeug ja „nur noch“ zusammengebaut werden. Dies ist dann der vierte Schritt, also die Endmontage, wo wir uns später in Halle 46 noch einen Eindruck verschaffen können. Und wir erfahren, dass in dieser Halle seit knapp 3 Jahren der vollelektrische EQS und der GLC Hybrid gebaut werden. Eine zweite Montagehalle, die Halle 56 oder auch Factory 56, stand ja vor 5 Jahren im Mittelpunkt fast aller Medien. Sie gilt auch heute noch als eine der größten und modernsten Montagehallen der Welt. Hier baut Mercedes die größten und teuersten Fahrzeuge wie z.B. die S-Klasse und den Maybach oder auch den EQS. Wie bei Mercedes nachzulesen ist, ist das wichtigste Merkmal der Factory 56 die maximale Flexibilität. Auf nur einer Ebene können in der Factory 56 sämtliche Montageschritte für Fahrzeuge verschiedener Aufbauformen und Antriebsarten erfolgen. Bedauerlicherweise können wir diese Halle nicht besichtigen, da unsere Gruppe hierfür zu groß ist.
Wir erfahren, dass aufgrund der großen Entfernungen zwischen den einzelnen Hallen bei jeder Führung ein Bus benötigt wird. Und auch uns wird später dann ein Bus zum Tor 1 fahren und von dort weiter zum Presswerk. Es folgen dann noch einige Informationen darüber, dass Daimler-Benz hier auf dem Werksgelände eine eigene Feuerwehr hat und auch ein großes Ärzteteam in der Nähe von Kantine 24 tätig ist, um Mitarbeiter bei Bedarf zu behandeln. Während der Fahrt durch das Werksgelände würden wir außerdem am Verladebahnhof und am Kraftwerk vorbeikommen.
Informationen, die uns doch ziemlich beeindrucken. Dann startet der Film, der uns nun in vielen Sequenzen und den begleiteten gesprochenen Texten bereits einen kurzen Überblick darüber verschafft, wie der Bau eines Daimlers erfolgt und welche Philosophie dahintersteht. Interessant der Start des Filmes, wo es gleich heißt: „Der Bau eines Automobils ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir machen das seit 130 Jahren. Und wir wollen nicht nur ein Auto bauen, sondern das Beste!“. Nach etwa 6 Minuten ist der Film zu Ende, die Bilder und diesen Satz haben wir allerdings noch etwas länger im Kopf.
Jetzt war auch der Zeitpunkt für unsere „Reise“ gekommen. Doch vorher wurden wir noch entsprechend ausgerüstet: Eine orangefarbene Warnweste, die uns als VIP ausweist, und die wir später als Erinnerungsstück mitnehmen durften. Dann noch ein Empfangsgerät sowie einen Ohrhörer. Dann erfolgte noch ein kurzer Soundcheck, und wer wollte, konnte die Lautstärke individuell einstellen.
Und schon kam der Bus und wir stiegen flott ein. Dann ging es auch gleich los: rechts wurden wir auf einen neuen CLA hingewiesen, der im März dieses Jahres im Rahmen einer Weltpremiere in Rom präsentiert wurde. Wie hieß es in der Presse hierzu: „Der neue CLA ist das cleverste und effizienteste Serienfahrzeug, das Mercedes-Benz jemals gebaut hat. Er ist ein innovatives Kraftpaket und berührt die Seele mit seinem markanten und athletischen Design.“
Und gleich danach wird unser Blick nach rechts auf das „Center of Excellence“ gelenkt. Eine Halle mit einer eindrucksvollen Außenarchitektur. Dann sehen wir links eines der vier Parkhäuser und erfahren dabei, dass die Mitarbeiter nicht mit ihren privaten PKWs in das Werk fahren dürfen. Kurz danach werden wir auf das Bildungszentrum hingewiesen. Dabei erfahren wir, dass pro Jahr etwa 250 Auszubildende eingestellt werden, deren Ausbildung je nach dem gewählten Beruf zwischen 2 und 5 Jahren dauert.
Rechts sehen wir dann die Züge von der Deutschen Bahn, die mit Daimler-Fahrzeugen beladen sind. Jeden Tag werden so etwa 90 Waggons beladen. Diese werden direkt nach Bremerhaven gefahren, dort auf Schiffe verladen und dann in ca. 150 Länder verschifft. Autos für Abnehmer in Europa werden nicht auf Züge sondern auf LKWs verladen. Danach fuhren wir an einer der Feuerwehren vorbei und hörten, dass es 20 Einsatzfahrzeuge und 80 Feuerwehrmitarbeiter gibt. Auch die Polizei, bzw. der Werkschutz, ist auf der linken Seite zu sehen, bevor dann unser Blick wieder nach rechts auf die größte Kantine des Werks gelenkt wird, in der ca. 1.000 Personen Platz finden. Dabei wird uns noch gesagt, dass sich über der Kantine die Werksärzte befinden. 16 Ärzte und 26 Sanitäter stehen hier bei Bedarf zur Verfügung. Es folgt dann noch der Hinweis auf die werkseigene Tankstelle.
Auf noch eine Besonderheit werden wir hingewiesen, bzw. gefragt, ob wir uns denken können, warum die Straße, die wir gerade befahren, kerzengerade ist. Und Herr Santaniello nennt uns auch gleich den Grund: So unterhielt die Daimler-Motoren-Gesellschaft seit 1915 eine eigene Abteilung Flugzeugbau hier in Sindelfingen. Während des 1. Weltkrieges wurden hier verschiedene Flugzeuge gebaut und entwickelt. Doch auch für uns verging die Zeit bis dahin wie im Flug, und schon sahen wir rechts die beiden Presswerke. Die Halle 17 war jetzt unser Ziel. Also raus aus dem Bus und rein in die Halle. Und da wurde vielen von uns die wahre Bedeutung des alten Sprichworts klar, wo es heißt: „Laut ist nicht immer Krach, doch Krach ist immer laut.“ Und es wurde schon ganz schön laut.
Hier im Presswerk werden Teilreihen für nahezu alle Baureihen gefertigt. Wobei hier in Sindelfingen auch Teile für die Werke in Bremen und Raststatt gepresst werden. Wir gehen an sehr vielen Stahl- und Aluminiumrollen vorbei, die von LKWs angeliefert werden. Das Gewicht einer Rolle liegt bei rund 20 Tonnen, wobei die Aluminiumrollen etwas leichter sein können. Und wir blicken auf die großen Werkzeuge oben. Wobei wir erst einmal verinnerlichen müssen, dass diese massiven Teile, die wir da oben sehen, einfach nur als Werkzeuge bezeichnet werden. Mit größter Präzision werden hier im Presswerk aus den Stahl- und Aluminium Rollen erst Platten geschnitten. Danach werden mit bis zu ca. 7.000 Tonnen Presskraft die verschiedensten Stahl- und Aluminiumbleche mit hoher Geschwindigkeit und höchster Präzision durch die entsprechenden Stanzformen gepresst und lassen so die benötigten Karosserieteile, wie Motorhauben, Türen, Seitenwände und Kotflügel entstehen. Schon faszinierend wie schnell es geht, aus einer Platine die passende Form zu pressen, um anschließend in der automatischen Zuschnittanlage die genaue Größe zu erhalten. Wie uns gesagt wird, werden alle Teile immer genauestens kontrolliert, und auch die Werkzeuge werden regelmäßig gewartet, um Störungen zu vermeiden. Und die vom Zuschnitt übrigen Teile werden laut Aussage nachhaltig recycelt.
Ebenfalls fasziniert schauen wir auch den Fahrerlosen Transportsystemen zu, die sich zielgerichtet in der Halle bewegen und den Materialtransport an die entsprechenden Montagebänder übernehmen. Generell sind wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen. Die meisten Arbeitsschritte erfolgen hier vollautomatisch. Und die tätigen Mitarbeiter wechseln immer alle 2 Stunden und haben danach eine Pause. Dies ist dem hohen Lärmpegel geschuldet. Auch sind die Mitarbeiter verpflichtet, einen Gehörschutz zu tragen.
Dann ging es mit dem Bus wieder weiter. Ziel war jetzt die Montagehalle 46. Auf dem Weg dorthin sahen wir rechts den Bereich Entwicklung und Forschung. Hier arbeiten die meisten Ingenieure. Wir fahren an den Hallen 34 und 44 vorbei, es ist der Bereich Lackierungen, wo die Rohkarossen lackiert werden. Und auf der linken Seite sehen wir eine große Baustelle. Hier entsteht eine der größten und modernsten Lackierungsanlagen. Diese soll im Frühjahr 2028 in Betrieb genommen werden. Dafür investiert Daimler-Benz 1 Milliarde Euro, wie uns gesagt wird.
Dann heißt es für uns wieder aussteigen, denn wir haben die Halle 46 erreicht. Hier können wir nun mehrere Montageschritte beobachten. In einem ausgeklügelten System arbeiten hier Menschen und Roboter zusammen. Am Montageband bleiben die Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten auf den sich langsam immer weiterbewegenden Montageband bis sie quasi mit diesem Auto fertig sind. Erst danach geht es wieder an das nächste Fahrzeug. Das Band verläuft in Schlangenlinien innerhalb der Halle. Wobei, wie wir auf Nachfrage erfahren, die Geschwindigkeit des Bandes je nach Bedarf variiert werden kann. Und auch hier erstaunt uns wieder, wie viele Fahrerlose Transportsysteme im Einsatz sind und den rechtzeitigen Materialtransport an die Montagebänder sicherstellen. Aber Autos stehen nicht nur auf den Bändern, sie werden auch von Robotern mit ihren Greifarmen in der Luft bewegt und befördert. Generell sind viele Roboterarme zu sehen. Wie von Geisterhand greifen sie sich irgendwelche Bauteile, drehen sie teilweise hin und her oder fügen sie zusammen, bevor sie die Teile an die dafür vorgesehenen Stellen befördern. Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, auf alles einzugehen, was wir auch hier in dieser Halle gesehen haben. Bestimmt schwirren vielen von uns auch heute noch etliche Bilder durch den Kopf. Als letztes Bild vielleicht der eine Mercedes, der an einem Greifarm eines Roboters in der Luft hing, und der, wie uns gesagt wurde, gerade auf dem Weg zu seiner Hochzeit war.
Hochzeit hier in der Montagehalle? Na klar, so wird das Ereignis genannt, wenn der Motor in die Karosserie eingebaut wird. Wobei es natürlich vorher eine Verlobung gegeben hat. Dann nämlich, als Motor und Getriebe auf die Achse des Fahrzeugs montiert wurden. Und so frisch verlobt, geht es dann weiter zur Hochzeit, wo jetzt Antrieb und Aufbau miteinander verbunden werden. Doch etwas gab es vorher ja auch noch: Vielleicht haben Sie ja den Mitarbeiter gesehen, der mit einem weißen Handschuh liebevoll ein Auto streichelte? Nein, nicht etwa, weil er Mercedes so gern hat. Seine Aufgabe ist es vielmehr, eventuelle Unebenheiten, die mit dem bloßen Auge meist gar nicht zu sehen sind, auf dem Metall zu erfühlen. Wir sehen dann auch, dass auf den Fahrzeugen Barcodes angebracht sind. Da je nach Kunde die Ausstattung eines Fahrzeuges ja sehr individuell sein kann, dienen diese Codes dazu, dass auch stets die richtigen Teile eingebaut werden.
Nach dem Besuch der Montagehalle ging es mit dem Bus wieder zurück zum Kundencenter. Während der Fahrt gab es noch einige Informationen aus der Historie von Daimler-Benz und Maybach. Zunächst zum Mercedes-Stern, dem dreizackigen Symbol für die Motorisierung zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und die Erklärung für den Kreis um den Stern gab es auch: Für Carl Benz war der Lorbeerkranz damals das Symbol für Erfolg. 1926 nach der Fusion der Daimler-Motoren-Gesellschaft und der Firma Benz & Cie. melden beide Marken ihr neues gemeinsames Logo an: Der Mercedes-Stern im Lorbeerkranz. Dass der Name „Mercedes“ sich vom Namen der Tochter des österreichischen Kaufmanns Emil Jellinek ableitet, war doch etlichen der Gruppe bekannt.
Dann wurden unsere Blicke auf den Verladebahnhof gelenkt und wir erfahren dabei, dass Daimler hier ein Schienennetz mit 12 Kilometer Länge unterhält. Und es ist schon etwas Stolz zu spüren, als uns Herr Santaniello berichtet, dass hier in Sindelfingen im Jahr so rund 250.000 Fahrzeuge gebaut werden. Das Werk gehört damit zu den größten Produktionswerken weltweit. Danach fahren wir am werkseigenen Kraftwerk vorbei, wo die gesamte Energie für das Sindelfinger Werk erzeugt wird. Überschüssige Energie kann an die Stadt abgegeben werden. Das Kraftwerk wäre in der Lage, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern zu versorgen. Und dann sind wir auch gleich wieder „am Stern“ angekommen. Herr Santaniello bedankt sich bei uns für unser Interesse und wünscht uns noch einen schönen Nachmittag. Und unsere Gruppe bedankt sich bei ihm mit einem kräftigen Applaus für die informative, sehr kompetente und gleichzeitig unterhaltsame Führung, bei der wir sehr viel Interessantes gesehen und erfahren haben.
Auch die andere Gruppe mit Frau Deutsch traf dann wieder ein. Hier waren die Kolleginnen und Kollegen ebenfalls von der Führung sehr angetan. Auch sie bedankten sich mit einem kräftigen Applaus. Und weil es so interessant und schön war, wollten einige der Damen noch gerne ein Erinnerungsfoto zusammen mit Frau Deutsch haben, und dies natürlich mit dem großen Mercedes-Stern. Nicht mit dem Stern aber mit der S-Bahn ging es dann für uns wieder nach Ludwigsburg zurück.
Aber egal, ob mit oder ohne Foto, ich bin sicher, wir alle erinnern uns sehr gern an diese tolle Veranstaltung unseres ASP. Und so gilt unser herzlicher Dank den beiden Kolleginnen Sonja Ehnle und Herta Stahl für die Idee zu dieser Veranstaltung und die sehr gute Organisation des heutigen Tages. Es hat uns allen sehr gut gefallen und wir freuen uns schon auf die nächsten ASP-Veranstaltungen. Denn Sie wissen ja längst: „Mit dem ASP isch’s halt immer schee!“
Horst Neidhart
Fotos: Petra Benub, Horst Neidhart, Rolf Omasreither
Gestaltung: Rolf Omasreither

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“, so heißt es in einem alten Sprichwort. Und wir alle haben uns beim 16. ASP-Infomarkt nicht nur auf die aktuellen Informationen aus unserer Kreissparkasse sowie über die anstehenden Aktivitäten unserer ASP gefreut, sondern eben auch auf die Begegnungen und das Wiedersehen mit unseren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Schon lange vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung waren die Plätze an den in Längsreihen aufgestellten und schön gedeckten Tischen im Louis-Bührer-Saal weitgehend besetzt. Und bei Kaffee und leckerem Kuchen kam schnell eine lebhafte Unterhaltung zustande.
Als dann unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Heinz-Werner Schulte die Bühne betrat, galt ihm sofort unsere gesamte Aufmerksamkeit. Denn wir waren alle sehr gespannt, was er uns Aktuelles aus unserer Sparkasse berichten würde. Er begrüßte uns sehr herzlich und betonte dabei, wie gut es doch tut, gerade in dieser schwierigen Zeit der Weltordnung in einem Haus zu sein, wo Verlässlichkeit, Solidität und Stabilität die Grundlagen für eine langfristig ausgerichtete Geschäftspolitik sind. Und er weist uns dabei auf das nächste große Jubiläum unserer Kreissparkasse im Jahre 2027 hin, wo dann das 175-jährige Jubiläum gefeiert werden kann.
Die weiteren Ausführungen zeigen auf, dass die derzeitigen weltpolitischen Entwicklungen auch Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Hauses haben werden und es daher wichtig sein wird, entsprechende Vorsorge zu treffen. Positiv dagegen der Blick auf die gute Entwicklung in 2024. So erreichten die Kundeneinlagen mit 9,4 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Anhand einiger Folien informiert uns Herr Dr. Schulte dann über die insgesamt positive Entwicklung unserer Sparkasse. Besonders erfreulich, dass nun zum ersten Mal die 2 Milliardengrenze beim wirtschaftlichen Eigenkapital überschritten wurde.
Dann der Hinweis auf die Mitarbeiter-App „Just Social“, die auch von uns Ehemaligen genutzt werden kann, um aktuelle Informationen zu erhalten. An einem Info-Stand konnten wir uns hierzu anschließend noch weitere Informationen beschaffen. Es folgte noch ein Hinweis auf die neuen Strukturen im Haus. Und auch, dass durch die frühzeitige Wahl eines weiteren Vorstandes ab Oktober bis Mitte 2028 der Gesamtvorstand vorübergehend aus 4 Mitgliedern besteht.
„Last but not least“ noch der Hinweis auf das diesjährige Firmen-Event und dass hierfür bereits 510 Anmeldungen vorliegen. Bei Interesse müssten weitere Anmeldungen aus unserem Kreis zügig erfolgen. Herr Dr. Schulte bedankt sich dann noch bei Herrn Rath und dem ASP-Team und wünscht uns allen weiterhin alles Gute.
Im Anschluss daran bedankte sich Herr Rath beim Vorstand für die Einladung zu dieser Veranstaltung und für die uns aufgezeigten, interessanten Informationen. Es freut ihn, uns alle hier im schönen Louis-Bührer-Saal zu sehen und damit auch deutlich zu machen, dass wir immer noch großes Interesse am Geschehen und an der Entwicklung unserer Kreissparkasse haben. Doch auch unser Interesse an den Angeboten des ASP-Teams erfreue ihn sehr und er informiert uns voll Stolz, dass im vergangenen Jahr 562 ehemalige Kolleginnen und Kollegen an den Veranstaltungen vom ASP teilgenommen haben. Und er weist darauf hin, dass wir mit unserem ASP ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der der deutschen Sparkassen haben.
Es folgt der Hinweis auf den folgenden Filmbeitrag mit dem Rückblick auf die Aktivitäten im Jahr 2024 und dem Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im laufenden Jahr. Sein besonderer Dank gilt dabei dem Produzenten dieses Films, dem Kollegen Rolf Omasreither. Ein kräftiger Applaus aus unseren Reihen ist auch unser Dank an den kreativen Kollegen. Herr Rath weist uns dann noch auf die Informationstische hin, wo wir von den jeweiligen ASP-Mitgliedern weitere Informationen zu den geplanten Aktivitäten erhalten und uns auch gleich dafür anmelden können.
Nachdem Corona bedingt in den letzten Jahren keine Busreisen angeboten wurden, verschafft sich Herr Rath ein Stimmungsbild aus unserem Teilnehmerkreis bezüglich der Bereitschaft, einen entsprechenden Eigenanteil an den Kosten für evtl. Busreisen zu bezahlen. Es folgt dann noch die Bitte, wenn eine angemeldete Teilnahme an einer Veranstaltung aus persönlichen Gründen doch nicht möglich ist, dies den Organisatoren der Veranstaltung kurzfristig mitzuteilen. Dadurch besteht die Möglichkeit für „Nachrücker“ auf der Warteliste, die bei ihrer Anmeldung damals nicht mehr berücksichtig werden konnten.
Herr Rath weist dann noch auf die Informationstische des Digitalen Vertriebs, des MBC und des Generationenmanagements hin. An einem weiteren Informationstisch können wir von unserem ehemaligen Kollegen Ewald Vogel Tickets und/oder Informationen zu einem Konzert von Rudy Giovannini am 19.09.2025 in Freiberg erhalten. Sein nächster Hinweis gilt der ASP-Homepage mit der Aufforderung an uns, diese doch immer wieder einmal anzuschauen. Und er verbindet diesen Hinweis mit dem Dank an den Kollegen Rolf Omasreither, der für die Gestaltung dieser Homepage verantwortlich ist. Sein Dank gilt aber auch Petra Benub, für ihre jeweiligen Beiträge im KONTAKT über die Aktivitäten des ASP, und Dieter Volz für dessen buchhalterische Tätigkeit im Rahmen der ASP-Veranstaltungen. Dann bedankt sich Herr Rath noch bei seinem gesamten ASP-Kernteam für dessen großes Engagement, was wir alle ebenfalls gerne mit einem kräftigen Applaus unterstreichen. Danach erhöhte Herr Rath nochmal unsere Spannung, in dem er eine spätere Überraschung verkündete, diese aber noch nicht preisgab.
Es folgte nun der Film „Rückblick 2024“ und „Ausblick 2025“. Mit flotter und zu jeder vorgestellten Aktivität passend ausgesuchter und unterlegter Musik konnten wir nun ganz entspannt die vielen Bilder und Videosequenzen der letztjährigen Veranstaltungen noch einmal vor unseren Augen Revue passieren lassen. Dabei wurden bei vielen der damaligen Teilnehmenden wieder etliche schöne Erinnerungen wachgerufen. Und manche der heutigen Anwesenden bedauerten, an der einen oder anderen Veranstaltung damals nicht teilgenommen zu haben. Doch vielleicht gab dann der filmische Ausblick auf die Veranstaltungen des laufenden Jahres ja den letzten Anstoß, sich dafür aber diesmal anzumelden. Entsprechend groß war dann auch der Andrang an den jeweiligen Informationsständen.
Doch was hatte es nun mit der angekündigten Überraschung an sich? Ich sage nur: Mambo, Samba, Rumba, Jive…Ja, damit hatten wir wirklich nicht gerechnet, dass plötzlich 3 noch sehr junge Tanzpaare des 1. TC Ludwigsburg auf der Bühne erschienen, um uns ihr schon ausgeprägtes Können zu beweisen. Ihre Trainerin, Frau Dagmar Beck, stellte uns die 3 Paare vor und begleitete deren Aufführungen vom Bühnenrand aus. Regelrechte Beifallsstürme waren jeweils unser Dank für diese gelungenen und mitreißenden Darbietungen, die ein echter Augenschmaus waren. Ich kann nur sagen: Überraschung gelungen! Und mancher von uns wünschte sich vielleicht im Stillen, auch noch einmal so flott und gekonnt über die Tanzfläche wirbeln zu können.
Erneut gelungen aber auch wieder der 16. ASP-Infomarkt. Mit vielen interessanten Informationen aus unserer Kreissparkasse, mit Informationen über die geplanten Aktivitäten des ASP-Teams, mit noch nachklingender Freude über die Begegnungen mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie den Bildern vom filmischen Rückblick und Ausblick im Kopf, verabschiedeten wir uns dann voneinander.
Unser aller Dank gilt hier noch einmal dem Vorstand für seine Einladung, dem ASP-Team für die Gestaltung und hohen persönlichen Einsatz sowie allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, die wie immer für einen reibungslosen und harmonischen Verlauf dieses Nachmittags sorgten.
Horst Neidhart
Das ganze ASP-Team möchte sich bei dieser Gelegenheit für den erneut ausgezeichneten Bericht bedanken.
Horst Neidhart, obwohl nicht Teil unseres Teams, verfasst seit genau 12 Jahren zu jeder von ihm besuchten Veranstaltung einen Bericht für unsere Homepage. Seine Reportagen sind unterhaltsam, lehrreich, humorvoll und sehr informativ. Immer wieder gelingt es ihm seine Leser zu begeistern so dass schon einige gesagt haben: „Wenn dem sei Bericht glesa hosch, brauchsch gar neme mit ganga. Do woisch elles“.
Was gibt es für ein schöneres Kompliment, dem wir uns auch sehr gerne anschließen.
Ältere Beiträge sowie Fotos finden Sie auf unserer Homepage unter „erledigte Berichte/Fotos“.
Fotos: Ralph Geiger, Rolf Omasreither
Gestaltung: Rolf Omasreither