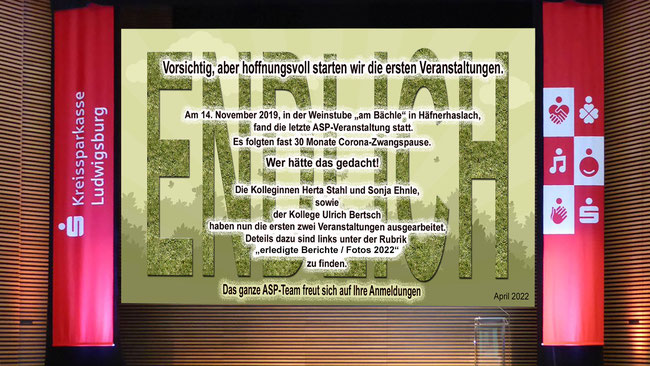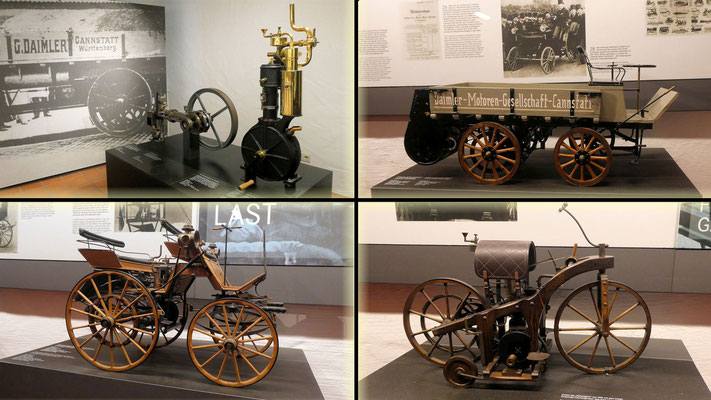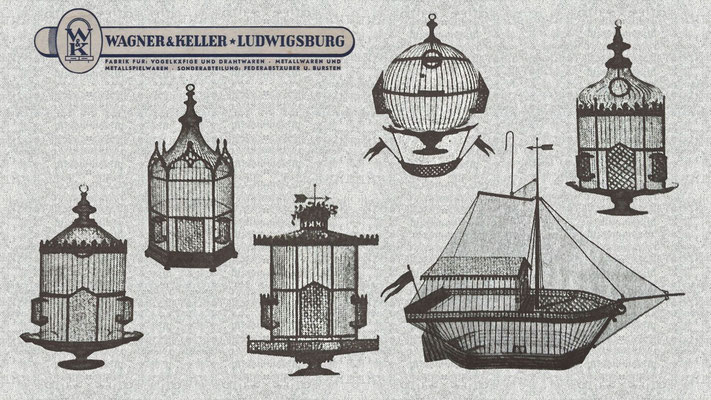Wenn das die Königin wüsste!
Habe ich Sie mit diesem Satz neugierig gemacht? Prima, denn neugierig waren wir, die 37 ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auch, was uns heute am 3. Mai 2022 im Residenzschloss Ludwigsburg erwarten würde.
Der erste Höhepunkt begann ja schon im Vorderen Schlosshof beim ersten Zusammentreffen nach so langer, pandemiebedingter Pause. Was war das für eine große Freude, sich bei einer Veranstaltung unseres ASP-Teams endlich einmal wiederzusehen. Lachende und strahlende Gesichter bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wie gut, dass die beiden Organisatorinnen des heutigen Events, Herta Stahl und Sonja Ehnle, vorausschauend genügend Zeit für diese Begrüßungsphase eingeplant hatten. Denn alle hatten sich ja so viel zu erzählen. Und viel zu erzählen hatten später allerdings auch die Kammerzofe und die Gouvernante, die beiden Bediensteten der Königin-Witwe Charlotte Mathilde. Doch dazu gleich mehr.
Denn zunächst gab es noch eine kleine Überraschung, quasi ein „Sekt-Frühstück“, um sozusagen den vom vielen Schwätzen schon etwas trocken gewordenen Mund wieder zu erfrischen, und sich mit einer Brezel noch etwas zu stärken. Und dann kamen auch schon die beiden Damen in ihren schicken, stilechten Roben auf uns zu. Für uns hieß es nun, sich zu entscheiden, welcher der beiden Damen wir uns anschließen wollten. Das ging alles sehr schnell, was auch immer den Ausschlag für die Entscheidung Kammerzofe oder Gouvernante gegeben haben mag. Vielleicht war’s ja auch nur so: „Mit wem goasch Du mit? – Dann mach I des au!“. Auf jeden Fall ging dieser Prozess ruck-zuck, und jede der beiden Hofdamen bat nun „ihre“ Gruppe, ihr zu folgen.
Um es gleich vorweg zu sagen: Diese Aufteilung macht es mir etwas schwer, über beide Führungen gleichwertig zu berichten. So wird mein Schwerpunkt darauf ausgerichtet sein, was die Kammerzofe Marianne aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Doch bezüglich des Lebens am Hofe dürften sich die Erzählungen beider Damen sehr geähnelt haben.
So will ich denn versuchen, Sie etwas auf unsere interessante – und gleichzeitig auch amüsante – Führung durch die charmante Kammerzofe Marianne Funk mitzunehmen. Einen wichtigen Hinweis gab uns die Zofe gleich vorweg: Wir schreiben das Jahr 1818. Die Königin Charlotte Mathilde von Württemberg ist seit 2 Jahren Witwe. Ihr Ehemann König Friedrich I. von Württemberg ist am 30. Oktober 1816 verstorben und die Königin nahm ihren Witwensitz im Residenzschloss Ludwigsburg. Damit konnte sie ihrem geliebten Mann nahe sein, der in der Ludwigsburger Fürstengruft unter der Schlosskapelle beigesetzt wurde.
Nach diesen einführenden Worten führte uns die Kammerzofe zur Treppe zu den königlichen Gemächern, verbunden mit dem Hinweis, dass die Benutzung dieser Treppe nur zu besonderen Anlässen und nur für besondere Gäste erlaubt sei. Kaum dass wir uns durch diesen Hinweis gerade noch sehr geehrt fühlten, gab es auch schon die erste Ermahnung durch unsere Führerin. Sie beanstandete, dass wir auf dieser Treppe quasi wie zuhause gehen würden. Sie bat uns, doch etwas stilvoller zu schreiten und ermahnte uns eindringlich, sollte uns hier die Königin-Witwe begegnen, sofort in tiefste Referenz zu versinken. Und für alle Fälle übten wir das auch gleich. Und wie es sich zeigte, wurden auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Gruppe von der Gouvernante darin unterrichtet. Denn schon bei der Begrüßung, als sie sagte, dass sie für die Erziehung der Prinzessinnen und Prinzen am Hofe zuständig sei und diesen die Regeln der Etikette beibringe, meinte sie gleichzeitig, dass manches davon sicher auch für die Teilnehmenden ebenfalls nützlich sein könnte. Wie es sich später zeigte, war es denn auch ihr Ziel, die Teilnehmenden in die Welt des guten Benehmens einzuführen. Ja, sogar die französische Sprache wurde dazu bemüht, „Oui, Mesdames et Messieurs!“
Apropos Sprache: Von der Gouvernante wurde die Gruppe auch auf die im damaligen Zeitalter wichtige „Fächersprache“ hingewiesen. Denn die Fächersprache ist schließlich die galanteste Sprache der Welt. Vor allem im Zeitalter des Rokokos war die große Blütezeit des Fächers und es war wichtig, die geheime Sprache des Fächers zu kennen, die ja hauptsächlich auf dessen Bewegungen oder Positionen beruht. Zeigte die Dame dem Herrn die helle Seite des Fächers, so hieß dies: ich bin interessiert. Und hielt sie dann auch noch den Fächer mit der rechten Hand vor ihr Gesicht oder ihre Augen, so lautete die Botschaft: Wenn ich gehe, folge mir! Allerdings hatten unsere Damen keine Fächer dabei – sie mussten also ihre Botschaften an die Kollegen mündlich weitergeben.
Doch zurück zu der Stelle, wo uns die Zofe ermahnte, sollte uns hier die Königin-Witwe begegnen, sofort in tiefste Referenz zu versinken. Nun ja, eigentlich waren wir uns ja sicher, dass uns die hohe Dame, die Königin-Witwe, heute nicht begegnen würde, da sie, wie uns berichtet wurde, derzeit ja mit ihrem gesamten Hofstaat (mit Ausnahme unserer beiden Führerinnen) zur Kur in Bad Teinach weilt. Und nur deshalb haben wohl auch diese beiden charmanten Bediensteten für uns Zeit und genießen vermutlich die Abwechslung durch unseren Besuch. Allerdings konnte die Gouvernante bei der Begrüßung ihr Erstaunen über unsere Kleidung nicht verhehlen und fragte denn auch ganz direkt: „Sind Sie denn her geritten?“
Im Laufe unserer Führung sind wir doch sehr erstaunt, wie redselig unsere Kammerzofe und auch die Gouvernante sind und uns quasi so nebenbei – wenn auch immer unter Hinweis auf strengste Diskretion - manches Geheimnis über die königlichen Gemächer und über das Leben am Hofe erzählen. Wie gesagt: Wenn das die Königin wüsste!
Unproblematisch dagegen die folgenden kurzen Ausführungen der Zofe zu Herzog Eberhard Ludwig, dem Gründer der Stadt Ludwigsburg. Dessen Interessen galten stärker seiner Jagdleidenschaft wie den Regierungsgeschäften. Da die Jagd jedoch in freiem Gelände erfolgte, musste er dazu immer von seiner Residenz in Stuttgart 2 Stunden mit der Kutsche bis in das freie Gelände von Ludwigsburg anreisen. Dies war ihm auf Dauer zu beschwerlich, und so beschloss er, eine Stadt zu gründen.
Um nun auch Bürger für diese Stadt zu gewinnen, verkündete er eine Steuerfreiheit von 10 Jahren, die er später sogar noch auf 15, und nochmals auf 20 Jahre erhöhte. Auch Religionsfreiheit wurde zugesichert. Zusätzlich bekamen Zuzugswillige auch noch einen Bauplatz geschenkt. Was waren das für Zeiten! Bedingung war jedoch, die Interessenten mussten einen ordentlichen Beruf ausüben. Doch wie uns die Zofe erzählte, dauerte es trotzdem etliche Jahre bis sich die Einwohnerzahl von anfangs 260 auf etwa 10.000 bis im Jahre 1818 erhöhte. Und sie verriet uns noch, dass die Stadt heute, also 1818 wie eingangs erwähnt, 32 Bäcker, 27 Metzger, 43 Schneider und 100 Wirte beherbergt.
Danach spürten wir, wie eine Traurigkeit unsere Kammerzofe überkam, als sie kurz ihren Vater erwähnte. Denn dieser war Mundschenk des früheren Herzogs Carl Eugen. Diese äußerst verantwortungsvolle Stellung brachte es mit sich, dass der Vater jeden Wein vorher probierte – und manche wohl auch mehrfach -, bevor dieser den Herrschaften oder Gästen serviert wurde. Wein war ja eines der Hauptgetränke an den adeligen Höfen und wurde nicht selten in Unmengen und exzessiv genossen. Und eines Tages – da versagte ihr fast die Stimme –, kurz bevor er in den verdienten Ruhestand eintreten konnte, ist ihr Vater nach der Ausübung seiner Pflichten bei einem Ausritt unglücklich vom Pferd gestürzt und verstorben. Daher ermahnte sie uns: „Kein Alkohol am Zügel!“
Kurze Erzählpause – in der wir mit der Zofe Marianne fühlten -, dann erhob sich ihre Stimme wieder als sie uns sagte, dass sie seitdem die Ehre habe, hier am Hofe zu arbeiten. Sie sei glücklich und habe weder Mann noch Kinder. Weshalb sie Letzteres so sehr betonte, blieb uns allerdings unklar. Doch vermutlich könnte sie ansonsten hier am Hofe nicht als Kammerzofe tätig sein. Vielleicht hat ihr jedoch auch die Gouvernante erzählt, wie schwierig es ist, die Kleinen manchmal richtig zu erziehen.
Anschließend erfuhren wir, dass man hier am Hofe nicht frei ist in der Wahl seiner Garderobe. Nein, alles schaut nach Paris! Und sobald dort ein neuer Stil kreiert wird, passiert Folgendes: Eine lebensgroße Holzpuppe wird entsprechend bekleidet und sofort von Paris nach Italien, London und Württemberg geschickt und sofort setzt geschäftiges Treiben ein. Kaum haben wir dies erfahren, stellt uns Zofe Marianne ganz direkt folgende Frage: „Trägt man eigentlich da, wo Sie herkommen, noch Flohfallen?“ – Ich gebe zu, diese Frage hat uns doch etwas überrascht. Aber Zofe Marianne klärt uns auf, dass es sich hierbei um kleine Schmuckstücke aus den erlesensten Materialien Glas oder Porzellan handelt. Und innen ist ein Stöpsel, der in Honig getunkt wird, oder noch besser, man legt ein Stück Fleisch hinein. Denn dieses schmecke den Flöhen besonders gut, wie uns die Zofe berichtet. Außen sind dann Löcher, damit die Flöhe hineinkriechen können. Entweder klebten sie dann fest oder wurden durch das aufgesaugte Blut so dick, dass sie nicht mehr durch die Löcher hinauskrabbeln konnten. So hat man diese lästige Plage gut in den Griff bekommen. Doch wie sagte später Wilhelm Busch so treffend: „Froh hüpft der Floh, vermutlich bleibt’s noch lange so.“
Inzwischen sind wir in der Bildergalerie angekommen. In diesem langgestreckten Saal im Verbindungstrakt zwischen dem Neuen Hauptbau und dem westlichen Kavaliersbau konnten wir die Bildersammlung des früheren Herzogs Karl Alexander bewundern. Dabei erzählt uns die Zofe, dass es die Königs-Witwe liebt, nach dem Essen einige Zeit im Garten zu verbringen. Aber wenn es draußen regnen würde, dann genieße sie hier in der Bildergalerie diese alten Gemälde, unter anderem das Deckengemälde des italienischen Malers Petro Scotti. Dieses stellt auf 16 Metern gemalt den Trojanischen Krieg dar. Die Zofe weist uns insbesondere auf die Szene hin, wo Achilles dargestellt ist, wie er den Leichnam Hektors am Pferd angebunden um die Trojanische Mauer schleift.
Dort wo die Chinesischen Vasen stehen, erzählt sie uns dann, dass sie als Zofe in einem Jahr 500 Gulden verdiene, eine Hofdame dagegen 800 Gulden, dazu freie Kost und Logis sowie eine bestimmte Menge an Naturalien. Dann erzählt sie uns noch im Vertrauen, dass die Königin-Witwe Heimweh nach ihren Eltern hat, und ihr Vater noch nie in Ludwigsburg war. Und sie erzählte uns weiter, dass ihr Vater eigentlich nicht wollte, dass seine Töchter heiraten. Er war der Meinung, dass diese ohne Mann ein glücklicheres Leben hätten. Die Zofe unterstrich dies noch mit der Bemerkung: „Vielleicht hatte er Recht. Schauen Sie mich an!“ – Nun, wir ließen diese Bemerkung unkommentiert im Raum stehen und erfuhren dann noch, dass die Mutter der Königin ihrem Gatten, König Georg III. 15 Kinder gebar und mit ihrem Gatten glücklich war.
Auf unserem weiteren Gang durch die königlichen Gemächer verriet sie uns dann noch, dass die Königin immer häufiger an Magen- und Darmbeschwerden leide. Der Medicus habe ihr daher geraten, mehr zu trinken, allerdings mehr vom „Heimischen des Landes und nicht von Malaga“. Und sie erzählte uns auch, dass die Königin-Witwe öfters Kopfschmerzen plagen. Dies führe sie allerdings darauf zurück, dass ihr in früheren Jahren einmal ein Kronleuchter auf den Kopf gefallen sei. Dies hätte sogar eine Narbe hinterlassen. Und als wir dann noch an einer Sänfte vorbeikamen, sagte sie uns in etwas leiserem Ton, dass die Königin-Witwe ja immer korpulenter werde und sich daher auch über kurze Strecken mit der Sänfte tragen lasse.
Kurz danach sind wir in der Ordenskapelle angelangt. Und wir erfuhren, dass König Friedrich I. den bisherigen herzoglichen Jagdorden zum Goldenen Adlerorden erhob und für dessen Versammlungen einen entsprechend gehobenen Rahmen gestalten ließ. Denn diesem illustren Orden gehörten neben Kaiser Napoleon die Könige von Preußen und Bayern sowie weitere Angehörige des Hochadels an. Goldverzierungen und Deckenmalereien verleihen der Kapelle eine festliche Atmosphäre. Und bis heute unverändert erhalten sind die umlaufenden Sitzreihen, auf denen die Ordensritter unter ihrem vergoldeten Wappenschild Platz nahmen.
Und damit kam unsere Zofe auf Napoleon zu sprechen. Dieser verlangte ja von König Friedrich für seinen Russland-Feldzug 15.000 Soldaten, von denen nach der verlorenen Schlacht nur noch 300 zurückkamen. Weiter erzählte sie uns, dass der König aus politischen Gründen und auf Drängen Napoleon Bonapartes seine geliebte Tochter Katharina an den jüngsten Bruder von Napoleon, an Jérôme Bonaparte von Westphalen, verheiraten musste. Nach der Schlacht von Waterloo (1815) wollte der König dann, dass seine Tochter wieder zu ihm zurückkehre. Doch habe die Tochter dann ihrem Vater eine Absage mit folgenden Worten übermittelt: „Ich wurde vor 7 Jahren aus politischen Gründen verheiratet. Nun aber habe ich meinen Gatten lieb gewonnen.“
Zurück zum König: wir erfuhren, dass der König zu seinem 58. Geburtstag mit seinen Gästen eine Jagd veranstaltete und die Jagdgesellschaft dabei lediglich 2 Stunden benötigte, um 823 Wildtiere zu erlegen. Doch wie uns die Zofe sagte, habe er diese Tiere nicht selbst gejagt, sondern sie wurden ihm direkt vor die Füße gelegt.
Kurz danach sind wir im Thronsaal angelangt, der ganz im Sinne des Klassizismus gestaltet ist. Unser besonderes Augenmerk galt hier der Deckenbemalung, welche von unserer Führerin als „Scheinarchitektur“ bezeichnet wird, da sie dem Betrachter viel höher erscheint, als sie tatsächlich ist. Als wir dann gemütlich weiter schlendern wollten, bekamen wir erneut einen Rüffel von unserer Zofe Marianne. Sie machte uns deutlich, dass wir hier immer darauf gefasst sein müssten, ein Mitglied des Hofes zu begrüßen. Und dies mussten wir nun unter Anleitung unserer Zofe üben. Und auch in der anderen Gruppe war diese Übung angesagt. Na ja, die Stellung der Füße und vor allem bei den Herren die Tiefe der Verbeugung müssen wohl noch etwas geübt werden. Denn wie sagte die Gouvernante doch sehr bestimmend zu den Kollegen: „Den Oberkörper so weit nach vorne beugen, bis er an das Knie reicht!“ Zugegeben, dies haben nicht alle geschafft. Doch Kollege Helmut Rath rettete die Ehre der Herren und zeigte, wie leicht ihm das doch fällt. Für weitere Übungen hatten wir jetzt allerdings keine Zeit mehr, denn wieder gab es einen kurzen Ausflug in die Geschichte.
So erfuhren wir, dass Herzog Friedrich damals mit 14 Männern nach England reiste, um seine Braut kennenzulernen. Die Reise dauerte 4 Monate, davon allein die Überfahrt mit 44 Stunden. Nachdem Friedrich seine Braut kennengelernt hatte, schrieb er – wie uns die Zofe verriet - folgende Zeilen über seine künftige Gemahlin an seine Mutter: „Sie hat einen schönen Teint. Und an ihr nicht so schönes Gesicht gewöhnt man sich dran.“ Und Kammerzofe Marianne verriet uns dann auch noch, dass man in ganz Europa bezüglich der Körperfülle beider Brautleute von der „Elefanten-Hochzeit“ gesprochen habe. Die Zeichnung eines Künstlers, die sie uns wieder unter dem Hinweis auf allerstrengste Diskretion zeigte, machte deutlich warum.
Das war dann auch schon der Übergang zu einem weiteren Thema. Denn Körpergröße und Leibesumfang von König Friedrich I. waren wohl doch sehr legendär. Da jedoch der König sehr gerne ausritt, war es ein Problem, ein geeignetes Pferd für ihn zu finden, welches in der Lage war, den Herrscher mit seinen über 2 Metern Körpergröße und über 200 Kilo Leibesgewicht sicher zu tragen. Nur die Schimmelstute Helene war ausreichend stark und wurde daher sehr schnell das Lieblingspferd des Königs. Zumal das Tier auch einen Trick beherrschte, um dem König den Aufstieg zu erleichtern: Man hatte der Stute nämlich beigebracht, sich wie ein Kamel niederzuknien und danach mit dem König wieder aufzustehen.
Wie uns die Zofe berichtete, liebte der König die Schimmelstute so sehr, dass er demjenigen mit dem Tod drohte, der ihm die Nachricht vom Tod des älter werdenden Tieres bringen würde. Als die Stute dann am 20. Mai 1812 im Alter von 27 Jahren starb, herrschte große Angst in der Umgebung des Königs, da dessen Jähzorn sehr gefürchtet war. Doch die Zofe berichtete uns von der Schlauheit eines Dieners. Er soll zum König gesagt haben: „Die Helene frisst nicht mehr. Die Helene säuft nicht mehr. Und die Helene steht auch gar nicht mehr auf.“ Worauf König Friedrich erschrocken darauf antwortete: „Dann ist die Helene wohl gestorben?“ Worauf der Diener jetzt antwortete: „Das habt aber jetzt Ihr gesagt.“
Auf unserem weiteren Weg durch die Gemächer des Schlosses kam erneut das Thema Rundungen zur Sprache. Denn wie uns die Zofe auch hier unter strengster Verpflichtung zur Diskretion verriet, war der König wohlgeformten Rundungen gegenüber sehr zugetan. Dies erklärt denn auch, weshalb es in den Gängen immer wieder Putten und Engelchen zu sehen gibt, die ihre Rundungen offen zur Schau stellen. Die abgewetzten Stellen an den diversen Körperteilen zeigen, dass hier wohl des Öfteren mit den Händen darübergestrichen wird.
Interessant auch der Hinweis auf den Ostgarten, in dessen See viele bunte Fische schwammen, in den Vogelvolieren sich viele exotische Vögel befanden und damals sogar zwei Kängurus umher hüpften. Der König hatte sie einst zur Hochzeit seiner Tochter aus der britischen Kolonie Australien extra exportieren lassen. Doch Napoleon hatte sie dann mitgenommen. Auch die Gouvernante kam auf den weitläufigen Garten des Schlosses zu sprechen und verwies stolz darauf, dass in diesem insgesamt 452 Bäume stehen. Als sie dann fragte, wieviel Bäume im Garten der Teilnehmer stünden und ein Kollege die Zahl 274 nannte, kam die trockene Bemerkung: „Aha, verarmter Landadel“.
Wir kamen in den nächsten Raum. Hier gab uns unsere Zofe die Empfehlung, bei einer eventuell anstehenden Renovierung unbedingt an Spiegel zu denken, da diese jeden Raum verschönern und vor allem auch vergrößern würden. Sie zeigte uns dies am Beispiel der an der Wand angebrachten Spiegel, die aus Venedig stammten. Diese waren jedoch sehr teuer. Dem trug Herzog Eberhard Ludwig dann Rechnung und gründete im Jahr 1700 den Ort Spiegelberg und ließ dort eine Spiegelmanufaktur errichten.
Und dann wurde wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, denn die Kammerzofe wollte uns jetzt unbedingt etwas über die Hygienebedingungen im Schloss erzählen. So erfuhren wir, dass man vor 100 Jahren daran geglaubt hat, dass Wasser Krankheiten überträgt. Dies gründete auf die Tatsache, dass man beim harten Arbeiten schwitzt. Wasser kommt aus den Poren, also müssen da Löcher in der Haut sein. Und wenn man sich dann in die Badewanne legt, kommt das Wasser dort herein. Doch wie uns die Zofe versicherte, glaubt man heute nicht mehr an „diesen Quatsch“. Und sie lässt uns wissen, dass die Königin einmal die Woche in einer Kupferwanne badet, die jedoch dazu mit Tüchern ausgelegt wird, weil Kupfer ja sehr heiß wird. Ansonsten wäscht sie sich morgens Gesicht und Hände und trocknet sich mit einem großen Tuch ab, bevor sie sich mit teurem Parfüm reichlich besprüht. Wie uns die Zofe dann mit verklärtem Blick erzählt, hätte sie uns heute gerne mit diesem Duft begrüßt – doch leider ist es den Kammerzofen nicht erlaubt, Parfüm zu benutzen und zu besitzen. Ein tiefer Seufzer begleitet diesen Satz.
Und mit bedrückter Stimme fragt uns dann die Zofe, ob wir uns noch an die große Hungersnot von 1815 erinnern könnten, was einige von uns natürlich kopfnickend bejahten. Sie schilderte uns noch einmal diese schreckliche Zeit mit wochenlangem Landregen, Dauerfrost, ohne Sommer und vor allem ohne Sonne. Was war die Ursache? Am 5. April 1815 hatte der Vulkan Tambora östlich von Java im heutigen Indonesien damit begonnen, Feuer zu speien. Die Eruption war der größte Vulkanausbruch der letzten Jahrtausende. Unfassbare 43 Kilometer ragte die Säule in den Himmel. 150 Kubikkilometer Asche und Gestein wurden in die Stratosphäre geschleudert, so dass keine Sonne mehr zu sehen war. Dieses Elendsjahr wurde daher auch „das Jahr ohne Sonne“ genannt. Oder später in der Literatur sogar als das berüchtigte Elendsjahr „Achtzehnhundertunderfroren“.
War es nur Zufall, dass wir während dieser Schilderung genau an einem Kanonenofen vorbeikamen? Wir könnten uns gar nicht vorstellen, sagte uns die Zofe, wieviel Dreck und Krach die Dienerschaft beim Heizen dieser Öfen machen würde. Und sie ergänzt ihre Ausführung noch mit dem Hinweis, dass diese Öfen aus Wasseralfingen kommen.
Dann standen wir in einem großen Zimmer mit einer schlichten weißen Decke mit goldenen Ornamenten, ganz im Sinne des Klassizismus. Wie wir erfuhren, war hier früher noch eine strukturierte Barockdecke, die jedoch auf Verlangen der Königin entsprechend der aktuellen Mode neu gestaltet wurde. Und wir erfahren, dass in diesem Raum nur in großer Gesellschaft gespeist wird. Dazu bedarf es in der Küche natürlich großer Vorbereitungen. Küchenjungen und Küchenmädchen müssen den Köchen bei der Zubereitung der Speisen helfen. Für den Braten gibt es dann extra Spezialisten: den Bratenwender und den Bratenmeister. Kesselweiber und Spülmenschen, meist Frauen, sorgen für Sauberkeit. Und wir erfahren, dass die Königin-Witwe keine klassische Hausfrau sei und sich in keinster Weise um den Speiseplan und das „ganze Drumherum“ kümmere.
Der Oberküchenmeister spricht den Speiseplan mit dem Haushofmeister ab. Dieser gibt dann seine Anweisungen den Köchen und den Bäckern. Auch der Silberkämmerling muss über den Speiseplan informiert sein, um die entsprechend benötigten kostbaren Besteck- und Geschirrteile ordentlich aufzulegen. Schließlich werden dann alle möglichen Sorten von Fleisch, Fisch, Geflügel und Meeresfrüchten kunstvoll aufgetragen. Alles natürlich sehr, sehr stark gewürzt, gegrillt, gebraten oder gepökelt.
Und wir erfahren, dass auch die königlichen Haushofmeister alle Hände voll zu tun haben, um zu verhindern, dass Speisen oder Getränke aus der Küche mit nach Hause genommen werden. Die Zofe erzählt uns dann noch eine nette Anekdote: Als nämlich einmal die Pagen einen Dessertteller geleert hatten, bevor dieser auf den Tisch kam, sagte die gütige Königin nur ganz freundlich: „Aber eine Orange könntet ihr mir doch noch lassen.“
Als wir dann schon fast am Ende unserer interessanten, abwechslungsreichen und meist auch humorvollen Führung angelangt waren, sagte unsere Zofe, dass sie uns – und hier insbesondere den Damen in unserer Gruppe - einen Satz der Königin-Witwe unbedingt nicht vorenthalten wolle. Diese sagte nämlich: „Ich finde, dass es das große Glück der Frauen ist, für ein häusliches Leben bestimmt zu sein. Und ich kann nur diejenigen beklagen, die aus ihrem Lebenskreis heraustreten und sich in Angelegenheiten zu mischen suchen, von denen sie nichts verstehen.“
Dann bittet uns Zofe Marianne noch eindringlich, alles was wir gehört und gesehen haben, in unserem Herzen zu bewahren und beim Verlassen der Schlossanlage unbedingt Vorsicht walten zu lassen, da manche Kutschen eine unverschämte hohe Geschwindigkeit hätten. Ob dies allerdings der Grund war, weshalb die Gouvernante ihre Gruppe noch in die Schlosskirche führte, sei dahingestellt.
Nicht mit hoher Geschwindigkeit, sondern gemütlichen Schrittes gingen die meisten von uns dann anschließend in den Schlosshof ins Café Schlosswache, um sich beim gemeinsamen Mittagessen noch einmal über das soeben Erlebte auszutauschen und wieder in die Gegenwart zurückzukehren.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass unseren beiden Kolleginnen, Herta Stahl und Sonja Ehnle, ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön gebührt für die Organisation dieses ganz besonderen Programms. Wie toll, dass es endlich wieder möglich war, gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Und mit der vom Kollegen Ulrich Bertsch vorbereiteten Wanderung rund um Affalterbach steht ja schon der nächste Programmpunkt an. Denn Eines ist ja auch trotz der langen Zwangspause noch immer gültig und hochaktuell: Einmal ASP – immer ASP! Und ich bin mir sicher, zu Hofe würde man uns um diesen Zusammenhalt beneiden. Oder wie ich schon eingangs schrieb: Wenn das die Königin wüsste…
Text: Horst Neidhart
Gestaltung: Rolf Omasreither

„Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, nicht mit den Autoreifen.“
Diesen Spruch des französischen Schriftstellers Georges Duhamel nahmen sich die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu Herzen und stellten deshalb am Dienstag, den 31. Mai 2022, ihre Autos auf dem Parkplatz an der Lemberghalle in Affalterbach ab. Denn dies war der Treffpunkt zum Start der Wanderung „Rund um Affalterbach“. Wanderführer Ulrich Bertsch freute sich über die 22 Kolleginnen und Kollegen, die hochmotiviert die 16 km lange Wanderstrecke absolvieren wollten. Und wieder war zu spüren und zu sehen, wie sich alle nach der langen Corona Pause über das Wiedersehen freuten. Doch zum Erzählen hatten wir ja noch während der Wanderung genügend Zeit, und so gab Ulrich Bertsch kurz nach 10.00 Uhr das Zeichen zum Start.
Nach wenigen Minuten gesellten sich dann auch noch die Kolleginnen und Kollegen zu uns, die Affalterbach mit Bahn und Bus erreicht hatten. Flotten Schrittes ging es nun weiter und bald hatten wir die Häuser von Affalterbach hinter uns gelassen. Auch am letzten Tag machte der Monat Mai noch einmal seinem Namen alle Ehre und bescherte uns tolles Wanderwetter. Zunächst konnten wir uns nun an einer schönen Wiesenlandschaft mit vielen Obstbäumen erfreuen, bevor uns der Weg dann oberhalb von Birkhau durch den Wald führte. Das frische Maiengrün der Bäume tat den Augen und der Seele gut. Es dauerte nicht mehr lange, und wir kamen an der Eugen-Feyhl-Schutzhütte vorbei. Doch noch hatten wir kein Bedürfnis nach einer Rast. Kurze Pausen entstanden nur dann, wenn uns Uli Bertsch einige interessante Informationen zur Landschaft vermittelte und uns dabei auf das vor uns liegende Buchenbachtal neugierig machte.
So erfuhren wir, dass es sich hierbei um ein Naturschutzgebiet handelt, welches auf dem Gebiet der beiden Gemeinden Affalterbach und Burgstetten liegt. Dieses landschaftlich besonders reizvolle Naturschutzgebiet erstreckt sich südlich der Murr und westlich sowie südwestlich von Burgstall entlang eben jenes Buchenbaches. Der Buchenbach hat eine Länge von 25 Kilometer. Er entspringt in den Berglen und mündet dann in Burgstall in die Murr.
Es dauerte nicht mehr lange und wir konnten uns auf unserem weiteren Weg am munteren Plätschern des Baches ebenso erfreuen wie an der schönen, idyllischen Landschaft, deren Bild sich ständig veränderte. Libellen und Schmetterlinge flatterten immer wieder um uns herum. Und von überall her hörten wir lautes und schönes Vogelgezwitscher, welches uns auf dem gesamten Weg entlang des Buchenbaches begleitete. Bald kamen wir an der Mühle von Wolfsölden vorbei. Erkenntlich durch die beiden an der Hauswand lehnenden alten Mühlsteine. Und bei genauerem Hinsehen konnte man an der Haustüre auch die Beschriftung „Wolfsöldener Mühle“ entdecken, sowie die über dem Türrahmen in Stein geritzte Jahreszahl 1780.
Nun überquerten wir eine der für das Buchenbachtal typischen historischen Bogenbrücken. Diese Bogenbrücken dienten einst den Fuhrwerken der Bauern, die darüber ihre abgeschiedenen, sogenannten Mäanderbögen erreichten. Diese Bauwerke sind heute als Kulturdenkmäler geschützt. An einer am Wegrand aufgestellten Informationstafel zeigte uns Uli Bertsch noch einmal den Verlauf des Buchenbaches, unseren derzeitigen Standort und den weiteren Wegverlauf. Dann geht es wieder zügig voran. Und immer wieder lohnt sich ein kurzer Blick auf den Buchenbach mit seinen vielen kleinen Stromschnellen, die das Wasser in der Sonne glitzern lassen. Aber auch der Blick nach links oder rechts ist immer wieder schön, verändert die Landschaft doch ständig ihr Gesicht. Blühende Holunderbüsche und auch blühende Wildrosen sind dabei stets neue Farbtupfer zwischen dem Grün der Bäume.
Als wir kurz vor dem Weiler Steinächle aus dem Wald herauskommen, wartet eine tolle Überraschung auf uns: Dort wo gerade eine Brücke neu über den Bach gebaut wurde, steht ein Pkw am Straßenrand. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch dann steigt Sigrid Bertsch aus diesem Pkw aus und öffnet den Kofferraum ihres Autos. Mit Hilfe ihres Mannes Uli beginnt sie dann, den Inhalt des Kofferraums auszuladen. Rasch wird sogar noch ein Tisch aufgestellt und mit einem Tischtuch abgedeckt. Und wir können es kaum glauben, was wir da zu sehen bekommen. Nein, ich meine jetzt nicht das dort angebrachte Werbeschild von der „Besenstube Kirschenhardthof“. Denn auf dem Tisch wurden uns lauter leckere Sachen serviert. Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass uns beim Anblick der frischen Butterbrezeln, des Hefekranzes und dem Schälchen mit den frischen roten Kirschen das Wasser im Mund zusammenlief. Dazu gab es auch noch diverse frische Getränke. Hier wurde uns sozusagen ein zweites Frühstück „par excellence“ serviert. Dieser Einladung konnten wir natürlich nicht widerstehen. Zumal dieser Haltepunkt auch noch sehr geschickt gewählt war, denn es gab sogar am Straßenrand genügend rustikale Sitzgelegenheiten. Bleibt noch einmal festzuhalten: Überraschung total gelungen! Ein ganz herzliches, großes Dankeschön für all die Köstlichkeiten und für die Mühe, die damit verbunden war. Es war ein weiteres Highlight dieser tollen Wandertour.
„Man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist“, so lautet ein altes Sprichwort. Dabei wäre es jetzt gerade so gemütlich gewesen – aber vor uns lag ja noch ein ganzes Stück des Weges. Doch kurz vor dem Aufbruch konnten wir in unseren Reihen noch einen Künstler bestaunen: Der Kollege Axel Mittendorfer überraschte uns mit einer gelungenen Jonglage, die er mit einigen vom Weg aufgehobenen Steinen perfekt vorführte. Da war ihm natürlich der Beifall von uns sicher. Da würde dann eher dieses Sprichwort passen: „Wenn dein Leben mit dir jongliert, nimm doch einfach selbst die Bälle in die Hand“. Oder wie Aristoteles sagte: „Es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie, indem wir sie tun.“ Vielleicht probiert ja mancher von uns dies nach dieser gelungenen Vorführung inzwischen schon selbst mit 3 Tennisbällen aus. Wer weiß…
Aber wir probierten jetzt alle erst einmal, ob wir nach dieser überraschenden, aber wohltuenden Pause und diesem köstlichen zweiten Frühstück unseren bis dahin flotten Wanderschritt erneut schaffen würden. Es ging ja gleich leicht bergauf, die ersten Häuser und das Ortsschild von „Steinächle“ waren schon zu sehen. Rechts am Rande einer Pferdekoppel gab es sehr seltsame „Ballone mit Haube“ zu sehen. Ob hier auf diese Weise wohl Regenwasser gesammelt wird? – Nein, falsch gedacht! Hier handelt es sich um Fallen für Bremsen. Denn speziell die Pferdebremsen können durch ihre Stiche den Tieren schmerzhafte Verletzungen zufügen.
Hier eine kurze Erklärung, wie diese Bremsenfallen funktionieren: Wird der schwarze Gummiball durch die Sonne erwärmt und von der Feder sowie dem Wind leicht in Bewegung versetzt, täuscht er der Bremse vor, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Versucht nun das Insekt in den stichfesten Ball zu stechen, prallt es von ihm ab und wird durch den weißen Fangschirm trichterförmig zum Wassergefäß geleitet, in dem es dann ertrinkt. Da die Pferdebremse eines der wenigen Tiere ist welches beim Starten vertikal aufsteigt, gelangt das Insekt automatisch in die Fangvorrichtung, aus der es nicht mehr ausbrechen kann.
Nach einem kurzem, leicht ansteigenden Wegstück haben wir dann den zur Gemeinde Affalterbach gehörenden Weiler Steinächle erreicht, wo wir als erstes von einem Pferd neugierig beäugt werden.
Erstmals wird „Steinach“ im Jahr 1304 im Lagerbuch des damals reich begüterten Katharinen Hospitals Esslingen verlässlich urkundlich erwähnt. Eine Aach war die altdeutsche Bezeichnung für Bach oder Fluss. Damit könnte Steinächle auch Steinbach heißen. Es lag an einer vorrömischen Straße, die bis ins 19. Jahrhundert hinein für den Handel mit Produkten aus dem Schwäbischen Wald genutzt wurde (Quelle: Stuttgarter Zeitung).
Und schon wieder werden wir beäugt, was Vielen von uns wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist. Denn an einem landwirtschaftlichen Gebäude blickt oben aus einem geöffneten Fenster ein kleiner, putziger Drache auf uns herab. Vermutlich beäugt er unsere Kollegin, die sich gerade an dem alten Dorfbrunnen etwas erfrischt. Aber auch für uns gab es in diesem heimeligen, kleinen Ort noch Manches zu bestaunen, sofern man eben die Augen dafür hatte und nicht gerade im Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen war. Denn manche Einwohner hatten die Vorgärten und Vorplätze ihres Anwesens kreativ geschmückt und dekoriert. Etliches davon lockte uns allerdings auch ein Schmunzeln ins Gesicht. Aber dies ist wohl so auch gewollt.
Bald hatten wir diesen kleinen, verträumt wirkenden Weiler wieder verlassen und gingen schnurstracks gerade aus weiter. Unser Weg führte uns jetzt durch eine offene Landschaft mit schönen Ausblicken. Dann kommen wir an einigen großen Pferdekoppeln vorbei. Das Wiehern einiger Pferde fassen wir als freundlichen Willkommensgruß auf. Wir erreichen nun den Böllenbodenhof, der bei Pferdefreunden für seine Island-Pferdezucht bekannt ist. Doch bei uns steht ja nicht Reiten, sondern Wandern auf der Tagesordnung. Also geht’s munter weiter bis wir auf der Anhöhe von Siegelhausen auf den Besinnungsweg stoßen. Der Besinnungsweg führt als Rundweg durch die Landschaft zwischen Bittenfeld und Siegelhausen und bietet dabei mit seinen zwölf Themenstationen die Möglichkeit der Besinnung. Wie wir auf der Informationstafel lesen können, geht es hier auf der Anhöhe um das Thema „Freiheit“. An den Holzskulpturen laden einzelne Zitate dazu ein, sich mit diesem – ja gerade auch in der heutigen Zeit – hochaktuellem Thema zu beschäftigen und sich dabei zu besinnen, was uns Freiheit gerade selbst bedeutet.
Ein Gefühl der Freiheit empfinden wir auch dann, als wir weiter durch die schöne Landschaft wandern. Die Gruppe hat sich inzwischen zeitweise etwas auseinandergezogen. Die Kolleginnen und Kollegen, die gerade einen Gang zurückgeschaltet haben, wundern sich plötzlich, dass sie von den etwas flotteren Teilnehmern, die jetzt auf einem Wiesenpfad weitergehen, nur noch die Oberkörper und Köpfe sehen. Das Gras links und rechts des schmalen Pfades ist hüfthoch gewachsen. Doch dies stört uns keinesfalls, denn unser Blick ist inzwischen schon auf den Lemberg gerichtet, und somit wissen wir, das Ziel ist nicht mehr weit. Noch kurz einen Weinberg hinauf und von oben den Blick über die Landschaft schweifen lassen. Dann über einige Treppenstufen bis zum Aussichtspunkt „Sieben Eichen“. Ein wunderschöner Rundblick von Ludwigsburg höchster Erhebung ist der Lohn für den kurzen Anstieg. So kann unser Blick vom Korber Kopf im Südosten über Stuttgart mit dem Fernsehturm bis zum Hohenasperg im Westen schweifen.
Nachdem wir uns zwar sattgesehen aber halt noch nicht sattgegessen haben, geht’s noch einige Schritte weiter. Und schon sind wir wieder am Parkplatz der Lemberghalle angelangt. Wie gut, dass unser Wanderführer Uli Bertsch unser Kommen dem Wirt bereits telefonisch avisiert und dieser für uns draußen im Freien eine lange Tafel gedeckt und vorbereit hatte. Denn jetzt freuten wir uns alle auf ein gemeinsames Abschluss-Essen und auf ein frisches Getränk je nach persönlichem Gusto.
Bleibt festzuhalten, Essen und Trinken hat allen gut geschmeckt. Und die Unterhaltung kam auch nicht zu kurz. Konnten wir doch auf dieser Wanderung sehr viele schöne und gleichzeitig auch die unterschiedlichsten Eindrücke sammeln. Ganz so, wie es die österreichische Fotografin Erika Hubatschek einmal so ausgedrückt hat: „Es gehört wohl zum Schönsten was es gibt, sich ein Land zu erwandern.“ Helmut Rath dankte daher im Namen von uns allen dem Kollegen Uli Bertsch für die gute Vorbereitung und die gelungene Durchführung dieser schönen Wanderung. Ein kräftiger Beifall von uns folgte. Und ein Lob gebührt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich diese Wanderung zugetraut und mit flottem Schritt auch sehr gut bewältigt haben. Viele schöne Eindrücke, die wir während unserer Wanderung sammeln konnten, werden sicher noch eine Weile in uns nachklingen. So sagen wir denn alle erneut – wie schon so oft – „Mit‘m ASP isch’s oifach schee!“. Das nächste Event steht ja übrigens auch schon fest: eine Stadtführung in Schorndorf. Wir freuen uns darauf und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen!
Text: Horst Neidhart
Gestaltung: Rolf Omasreither

„Stadtführung für jedes Alter,
macht viel Freude mit Lepperts Walter!“…
…dass dies kein leeres Versprechen eines unserer beiden Stadtführer war, davon konnten wir uns im Laufe eines interessanten Nachmittags immer wieder aufs Neue überzeugen. Doch beginnen wir von vorn: Treffpunkt am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 09.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg. So stand es in der Einladung unseres ASP-Teams für die geplante Stadtführung in Schorndorf, der Heimatstadt von Gottlieb Daimler. 44 (!) Teilnehmer*innen, darunter etliche „Ersttäter“, haben sich am Bahnhofsvorplatz getroffen, Was war das wieder für ein Hallo, und was gab es nicht wieder alles zu erzählen. Viele gaben ihrer Freude Ausdruck, dass es endlich wieder Aktivitäten unseres ASP-Teams nach der langen Corona-Pause gibt. Dann ergriff Helmut Rath, der es sich nicht hat nehmen lassen, persönlich am Bahnhof zu erscheinen, kurz das Wort. Er begrüßte uns alle herzlich und wünschte uns einen interessanten und schönen Tag. Auch die beiden Hauptakteure des heutigen Tages vom ASP-Team, die Kollegin Monika Lang und der Kollege Frieder Rutte, freuten sich sichtbar über die hohe Zahl der Anmeldungen, und freuten sich ebenfalls darauf, diesen Tag mit uns gemeinsam zu verbringen. Bereits die Gespräche am Bahnhof machten deutlich, dass wir alle schon sehr gespannt waren, was wir bei dieser Stadtführung alles sehen und erleben würden. Und alle waren wir darüber hinaus sehr froh, dass heute auch der Wettergott auf unserer Seite war. Zwar hatten wir ja fast alle einen kleinen Schirm dabei – den wir später auch mal ab und zu etwas benötigten -, aber es war nicht so heiß und drückend wie in den zurückliegenden Tagen.
Dann pünktlich um 10.21 Uhr Abfahrt Gleis 3., natürlich mit Verkleidung, sprich Maske. In Stuttgart am Hauptbahnhof erstmal ein kleiner Fußweg wegen der Baustelle von S21, bis es dann wieder mit dem Zug weiterging nach Schorndorf. Dort angekommen führte uns Frieder Rutte zügigen Schrittes an der Arnoldgalerie – einem sehr großen Einkaufscenter - vorbei zum Kesselhaus, wo wir später um 12.00 Uhr gemeinsam unser Mittagessen einnehmen wollten. Dabei kamen wir zum ersten Mal an dem neuen Postturm vorbei, von wo uns eine große rote Blume auf einem riesigen Plakat sofort ins Auge fiel. Mit diesem Kunstobjekt soll auf ein Projekt des Kinderschutzbundes aufmerksam gemacht werden. Nun hatten wir noch ca. eine ¾ Stunde Zeit für einen ersten kleinen Stadtbummel in eigener Regie. Schon bei unseren ersten Schritten konnten wir etwas von diesem besonderen Flair dieser schönen Stadt in uns aufnehmen, was natürlich unsere Neugier auf die spätere Stadtführung noch erhöhte. Doch wie hatte uns Frieder Rutte eingeschärft: 12.00 Uhr Mittagessen im Kesselhaus! Also ging es jetzt wieder dorthin zurück.
Und dann standen wir wieder vor diesem großen über 100 Jahre alten Industriegebäude aus rotem Backstein mit seinem riesigen Schornstein, was von außen den Industrie-Flair einer ehemaligen Fabrik ausstrahlt. So lässt auch dieser erste Eindruck noch nicht erahnen, was uns dann beim Eintritt in das Gebäude erwartet. Daher kurz zur Historie: dieses Gebäude wurde 1895 als Kesselhaus von der Eisenmöbelfabrik Arnold erbaut. Hier stand in der Mitte des Hauptraumes ein Heizkessel, welcher über die ganzen Jahre hinweg das gesamte Betriebsgelände (heute die Arnoldgalerie) mit Wärme und Energie versorgte. Nach der Betriebsaufgabe der Firma Arnold ging der gesamte Besitz durch Kauf an die Stadt Schorndorf über. Mit der Wiederbelebung des Arnold-Areals wurden die Arnoldgalerie, das Museum für Kunst und Technik, Büroräume, ein Parkhaus und die Gasthausbrauerei als Gastronomieobjekt verwirklicht.
Als wir dann eintreten, überwältigt uns schon der erste Eindruck. Unsere Blicke wandern zwischen der mehr als zehn Meter hohen Decke, den mächtigen Kesseln, den zwei Emporen und dem aufgestellten Mobiliar hin und her. In der Tat ein außergewöhnliches Haus, welches insgesamt 400 Sitzplätze im Innenbereich und noch ca. 160 Plätze im Außenbereich zu bieten hat. Für uns war einer der großen Nebenräume reserviert. Flugs wurden Getränke und Essen bestellt. Und auch jetzt war wieder deutlich zu erleben, dass wir uns alle doch recht viel zu erzählen hatten. Was letztlich den Lautstärkepegel im Raum ziemlich anhob, zumindest bis dann das Essen an die Tische serviert wurde. Mit der Wahl dieser Gaststätte haben Monika Lang und Frieder Rutte eine sehr gute Wahl getroffen, denn die servierten Speisen waren lecker und auch reichlich.
Dann aber war es Zeit für die angesagte Stadtführung. Ein Stadtführer im „Gottlieb Daimler-Look“ war bereits da. Als er im Gespräch mit einem von uns meinte, dass wir ja jetzt nicht mehr aktiv seien (er bezog dies vermutlich auf unsere berufliche Tätigkeit), widersprachen wir natürlich heftig und sagten ihm, dass wir ja jetzt die Aktiven Sparkassen Pensionäre wären. Bald danach traf auch der zweite Stadtführer ein, ebenfalls im „Daimler-Outfit“. Denn aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mussten zwei Gruppen gebildet werden. So scharten sich denn um die beiden Stadtführer namens Walter Leppert und Eduard Schall jeweils 22 neugierige und interessierte Kolleginnen und Kollegen. Ich selbst war in der Gruppe von Walter Leppert.
Ja, und dann gings los. „Mir nemmad d’r kürzeschte Weg zom Marktplatz. Dort fanget m’r a.“ so unser Führer alias Gottlieb Daimler im breiten Schwäbisch. Und als eine Kollegin ihren Schirm aufspannte, weil es leicht zu regnen anfing, meinte er, dass er morgens noch Rasen gemäht habe. Als es da auch etwas zu regnen anfing, hätte er gemeint: „So goht des net. Jetzt kommet Gäscht, da muaß schö’s Wetter sei!“
Während wir dann weiter in Richtung Marktplatz gingen, erfuhren wir noch, dass seine Frau früher ebenfalls bei der Sparkasse eine Lehre gemacht hätte und später dort auch arbeitete. Er sei 40 Jahre selbständig als Versicherungsmakler für die Württembergische Feuerversicherung tätig gewesen. Sein Leitspruch lautete immer: „Bevor es scheppert, geh‘ zu Leppert“. Ein herzhaftes Lachen von uns war ihm sicher.
Und dann standen wir auch schon am Oberen Marktplatz. Wir erfuhren, dass Schorndorf zum ersten Mal 1235 urkundlich erwähnt wurde, als kleine alemannische Besiedelung um ein altes Holzkirchlein herum. Das gesamte Remstal sei damals noch sehr spärlich besiedelt gewesen.
Graf Ulrich von Württemberg wollte um 1250 dann hier eine Stadt errichten. Seine Gründe waren demnach: Waiblingen (die Stauferstadt) war hundert Jahre älter, die andere Stauferstadt war Schwäbisch Gmünd. Und dazwischen wollte der Graf nun eine Anlaufstelle für die Bevölkerung haben. So begann er dann hier, hinter diesen wunderschönen Apothekerhäusern, 1250 die Stadt zu errichten. Die „Obere Stadt“, wie man damals sagte. Heute ist es die „Oststadt“.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts entwickelte sich der Ort rasch und zählte bereits im späten Mittelalter nach Stuttgart, Tübingen und Urach zu den bedeutendsten Städten der Grafschaft Württemberg. Wie wir erfuhren, hieß der Ort damals vermutlich „Shorendorf“. Und es sei nicht belegt, wie es dann zum Namen „Schorndorf“ überhaupt gekommen sei. War eventuell ein etwas „schlampiges Schwäbisch“ schuld daran? Diese Frage konnte auch unser Führer nicht beantworten. Aber er wies uns auf das Stadtwappen von Schorndorf hin: Unter goldenem (oder gelbem) Schildhaupt befindet sich eine liegende, schwarze Hirschstange als Hinweis auf die Herrschaft der Württemberger, und in Rot zwei schräg gekreuzte, mit dem Blatt nach oben gekehrte, goldene (oder gelbe) Spaten, die hier auch „Schoren“ genannt werden.
Ein Brunnen auf dem neu entstandenen Marktplatz wird erstmals 1478 erwähnt, 1522 zierte den Platz ein steinerner Brunnen mit einem Standbild Herzog Ulrichs. Dann wurden wir plötzlich gefragt, ob wir eine Ahnung hätten, warum wir ausgerechnet hier an diesem Platz stehen würden? Und wir erfuhren, dass hier früher eine tiefe, breite Schlucht verlief, die bis zum heutigen Bahnhof hinunter reichte. Der Herzog begann dann die Stadt zur Landfeste auszubauen. Hierzu ließ er 2 Kilometer um die Stadt herum einen Erdwall aufschichten, der 35 Meter breit und 15 Meter hoch sowie verdichtet wurde. Außerdem begann er mit dem Bau der kompletten Stadtmauer mit 18 Wehrtürmen und 4 Durchgängen und um das Ganze herum noch einen Stadtgraben. Damit war Schorndorf quasi nicht mehr einnehmbar. In den nächsten 80 Jahren entstand dann hier in diesem ehemaligen Graben der Marktplatz, der heute der wichtigste Mittelpunkt der Stadt ist.
Wir bekamen dann die Empfehlung, Schorndorf einmal am Samstag zu besuchen und auf den Markt zu gehen, um so das besondere Flair zu genießen. „Im Gegensatz zu Ludwigsburg, wo ja alles etwas größer ist, ist in Schorndorf alles klein und schnuckelig“ war die Aussage. Dagegen überhaupt nicht klein und schnuckelig, sondern auf 360 Hektar wurde damals in und um Schorndorf herum bis ins Wieslauftal oder bis Urbach Wein angebaut. Denn Wein wurde seinerzeit gehandelt. Unser „Daimler“ erzählte uns dann von den Fuhrleuten, die mit ihren Pferdegespannen wochenlang nach Wien und ins Salzburger Land unterwegs waren. Auf dem Retourweg haben sie aus dem Berchtesgadener Land dann das „weiße Gold“, sprich Salz, mitgebracht. So hat Schorndorf sehr schnell ein Salzmonopol bekommen. Herr Leppert erzählt uns noch kurz, dass er unlängst eine Schulklasse geführt habe. Als er dabei auf dieses Thema zu sprechen kam und die Schüler fragte, was sie glauben würden, was die Fuhrleute aus dem Berchtesgadener Land mit nach Hause genommen hätten, sei spontan „Koks“ die Antwort gewesen. Da mussten auch wir schon etwas schmunzeln.
Dann werden wir gebeten, unsere Blicke auf die Rundbögen des Rathauses zu richten. Denn auch das frühere Rathaus hatte damals solche - allerdings offene - Rundbögen, damit die Fuhrleute mit ihren Gespannen reinfahren konnten. Und innen in der Markthalle wurde alles Verderbliche gehandelt. Auch die Brotlauben befanden sich früher dort. Das waren die Verkaufsräume für die Schorndorfer Bäcker. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen diese Brotlauben jedoch aus der Mode.
Weiter ging es in unserem „Geschichtsunterricht“. So kamen wir jetzt auf die große Schlacht bei Nördlingen (1634) zu sprechen. Die (katholischen) kaiserlichen Truppen hatten damals ja die Schlacht bei Nördlingen gegen die Protestanten überlegen gewonnen. Laut Überlieferung gab es dabei über 10.000 Tote. Die Überlebenden hätten sich dann gedacht, ganz da unten gibt es die Festungsstadt Schorndorf. Da gucken wir, dass wir hineinkommen und uns verbarrikadieren, dann kann uns nichts passieren. Das hätten sie wohl auch geschafft. Aber der Bevölkerung ging es danach auch sehr schlecht. Denn am 24. November kamen die kaiserlichen Truppen nachgerückt. Sie nutzten die strategisch günstige Lages des Ottilienberges, der sich in Luftlinie rund 1,3km südlich des Schorndorfer Marktplatzes befindet, und beschossen die Stadt von hier aus mit glühenden Eisenkugeln. So wurde die Stadt in Schutt und Asche gelegt und ist fast völlig abgebrannt. Von den vorherigen 4.000 Einwohnern waren nur noch ca. 10 Prozent am Leben. Dazu kamen dann noch die vielen Dahinsiechenden aufgrund von Pest und Cholera. Diese wurden dann auf dem „Siechenfeld-Friedhof“ bestattet. Von diesem schweren Schicksalsschlag hat sich Schorndorf nur sehr langsam wieder erholt.
Bei diesem großen Stadtbrand wurde auch ein Großteil der Stadtkirche ebenfalls zerstört. Der erneute Aufbau dauerte dann bis 1660. Durch häufige Restaurierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bis in die heutige Zeit hinein, weist die Kirche verschiedene stilistische Einflüsse auf, wovon sich die Gruppe um Stadtführer Eduard Schall überzeugen konnte. Ab 1902 erfolgte eine gründliche Außen- und Innenrenovierung. Dabei wurden die beiden oberen Geschosse des Turms im neugotischen Stil errichtet. Im Inneren der Kirche erfolgte 1958 dann eine letzte große Umgestaltung, die weitgehend wieder der früheren Raumgestaltung entspricht. Beim Innenraum der Kirche fällt vor allem auf, dass Seitenschiffe fehlen. Diese wurden damals ebenfalls durch den Stadtbrand von 1634 zerstört. Eine besondere Rarität ist in der Taufkapelle das dortige Deckengewölbe mit seinem Ornament der Wurzeln Jesse. Aber auch die prunkvoll geschnitzte Kanzel von 1660, die vom Stil her zwischen Spätrenaissance und Barock steht, fällt dem Besucher sofort ins Auge. Die Stadtkirche selbst ist mit ihrem 63 Meter hohen Turm neben dem Rathaus einer der imposantesten Blickfänge der Stadt. Die Teilnehmer der anderen Gruppe haben ja die Chance, bei einem späteren eigenen Besuch der schönen Stadt Schorndorf auch einen Besuch in der Stadtkirche mit einzuplanen.
Lenken wir unseren Blick wieder auf den Marktplatz. Wie wir erfahren, sind die Häuser, die wir hier am Marktplatz sehen, alle erst wieder nach 1650 erbaut worden. Glücklicherweise sei Schorndorf jedoch dann in den beiden Weltkriegen verschont geblieben. Jetzt erfuhren wir noch etwas von einer netten „Nachbarschaftshilfe“: Schorndorf hatte ja nach diesen schrecklichen Vorgängen auch kein Rathaus mehr. Aber in Urbach, der Nachbargemeinde, gab es ein schönes, nicht mehr genutztes Fachwerkhäusle. Und dieses schenkten die Urbacher jetzt den Schorndorfern, damit der dortige Magistrat wieder eine Unterkunft bekam. Dieses „Häusle“ stand dann noch 86 Jahre, wie wir erfuhren. Insgesamt hat es 92 Jahre gedauert, bis Schorndorf dann wieder sein eigenes Rathaus bekam. Hier erhielten wir dann noch den Hinweis auf den Stadtbaumeister Georg-Friedrich-Majer, der ja bekanntermaßen auch am Bau des Ludwigsburger Schlosses mit beteiligt war. Dieser ließ sich für das Schorndorfer Rathaus vom Bau des Ludwigsburger Schlosses inspirieren und plante 1726 entsprechend den Bau des neuen Rathauses. Dies lässt sich im Übrigen am schmuckvollen Portal des Rathauses gut nachvollziehen.
Das Rathaus wurde im Jahr 1730 fertiggestellt. Es bildet die Grenze zwischen dem Oberen und Unteren Marktplatz. Das schmucke Gebäude mit seinem barocken Baustil, mit den bodentiefen Rundbogenfenstern und den stattlichen Säulen hat auch unsere Blicke auf sich gezogen. Über dem Eingang befindet sich ein Balkon mit Balusterbrüstung. Außerdem ist das Stadtwappen abgebildet. Auch eine Inschrift ist zu sehen: „AEDES DEO SACRA – CURIA SCHORNDORFINA POST NOVEM DECEN__IA DUOSVE AN__OS E CINERIBUS RESTITUTA – ANNO – MDCCXXVI“. Übersetzt heißt es, wie wir erfuhren: „Dieses Haus ist Gott geweiht. Das Schorndorfer Rathaus nach 92 Jahren aus der Asche wiedererstanden im Jahre 1726“. Auf dem Walmdach des Rathauses befindet sich in südlicher Richtung ein Glockenstuhl, und die Vorderseite des Daches wird durch einen achteckigen Glockenturm geschmückt.
Doch nicht nur die Vorderseite des Rathauses ist ein Höhepunkt bei unserer Stadtbesichtigung. Daher wenden wir uns nun der Rückseite des Gebäudes zu. Hier verweilen wir vor einem großflächigen Mosaik (5 x 20 Meter) des Künstlers Hans Gottfried von Stockhausen, das 1965 hier angebracht wurde. Dieses Mosaikbild aus rund 80 verschiedenen Marmorsorten zeigt die „Schorndorfer Weiber“, die durch ihr mutiges Verhalten ja bekanntermaßen die Stadt vor der Übernahme durch die Franzosen bewahrt und gerettet haben.
Wir erhalten dann einen kurzen Abriss über die damaligen Vorgänge: Nachdem zu Beginn des Pfälzischen Erbfolgekrieges Philippsburg bereits von den Franzosen eingenommen wurde, marschierten die Truppen weiter nach Württemberg, dessen Truppen ja noch in dem Krieg des Kaisers gegen die Türken gebunden waren. Die Truppen zogen gewalttätig durchs Land und brannten auch einzelne Städte nieder. Im deutschen Südwesten wurde Mélacs Name zum Inbegriff für „Mordbrenner“ oder „Marodeur“ schlechthin. Daher begann die Regierung des Herzogtums mit den Franzosen über deren Forderungen zu verhandeln. Dabei wurde beschlossen, dass die Feste Schorndorf den französischen Truppen unter der Führung des Generals Mélac übergeben werden sollte. In Schorndorf waren jedoch weder der Festungskommandant Krummhaar noch die Bürgerschaft zur Übergabe bereit. Deshalb wurden mehrere Boten zu den umstehenden Befehlshabern der kaiserlichen Truppen geschickt, um von diesen Unterstützung zu fordern. Doch dann trafen zwei Abgesandte der Stuttgarter Regierung auf dem Schorndorfer Rathaus ein, um den Magistrat Schorndorfs zur Kapitulation zu bewegen.
Und damit kamen wir zum Thema „Frauenpower – Heldinnen braucht das Land!“. Die Ehefrau des Bürgermeisters, Barbara Walch (später Künkelin) wollte aber unter gar keinen Umständen eine Übergabe der Stadt zulassen. Doch bevor unser Führer auf die Vorgänge einging, sagte er noch ein paar Sätze zur Biographie dieser tapferen Frau: Anna Barbara Walch-Künkelin wurde 1651 als Tochter des Apothekers Jakob Heinrich Agricola in Leutkirch geboren. Im Alter von 25 Jahren zog sie nach Augsburg zu ihrem Onkel, einem Kaufmann und Bürgermeister von Augsburg, dem sie den Haushalt führte. Wie unser Führer dann im breitesten Schwäbisch fortfuhr, empfahl ihr vermutlich der Onkel den zweimal verwitweten und 25 Jahre älteren Metzger und Lamm Wirt sowie Bürgermeister Johann Heinrich Walch, zu heiraten, was sie 1679 dann auch tat. Nach dem Tod ihres Mannes 1689 heirate sie anschließend Johann Georg Künkelin, ebenfalls Bürgermeister in Schorndorf. Barbara Walch-Künkelin starb im Alter von über 90 Jahren am 20. November 1741.
Doch weshalb wurde Barbara Walch-Künkelin so berühmt und wird in Schorndorf noch heute verehrt? Wie oben erwähnt, wollte Barbara Künkelin die Übergabe Schorndorfs auf keinen Fall akzeptieren. Als Frau des Bürgermeisters wusste sie sehr wohl, dass die Magistrate dem Herzog bedingungslose Treue geschworen haben. Aber sie sagte, wie unser Führer schelmisch anmerkte: „Wir haben niemand die Treue geschworen. Höchstens unseren Männern, oder auch nicht.“ Insoweit fühlte sich die Bürgermeisterin durch keinen Treueschwur gebunden. So wurde in Übereinstimmung mit dem Festungskommandanten Krummhaar der schlaue alte Weingärtner Kurz beauftragt, alle Frauen Schorndorfs zusammenzurufen. Er forderte sie auf, sich zu bewaffnen und vor Künkelins Haus zu kommen. Ohne viel weibliches Gerede wurde beschlossen, mit schonungsloser Energie zu verhindern, dass die „schwachmütige Obrigkeit einem liederlichen Trüpplein Franzosen die Ehre und die Habe, wenn nicht gar auch die Tugend der Weiber von Schorndorf feige und schmählich überliefere“. Bewaffnet mit Mistgabeln, Messern, Hellebarden und Sicheln stürmten sie dann unter Führung Barbara Künkelins das Rathaus mit den Worten „Tod den Verrätern“. Nun gaben die Weiber in Schorndorf den Ton an. Sie ließen die Stuttgarter Unterhändler drei Nächte und zwei Tage nicht aus dem Gebäude. Als dann am 17. Dezember 1688 der französische General Mélac mit seinen Truppen aufmarschierte, wartete er vergebens auf die Übergabe Schorndorfs. Krummhaar und die Bürgerschaft hofften weiter auf Unterstützung durch kaiserliche Truppen, die dann auch noch eintrafen. Nun musste Mélac fliehen; Schorndorf war durch den Mut der Frauen gerettet und konnte sich somit als einzige württembergische Festung halten.
Die Historikerin Gudrun Emberger-Wandel schreibt in ihrer Künkelin-Biographie: „Erst wir Heutigen können die Tat der Schorndorfer Weiber als das würdigen, was es wirklich war: als einen bemerkenswerten Akt bürgerlichen Ungehorsams, des Aufbegehrens gegen die verfehlte Politik der Obrigkeit, des Widerstands gegen die Rolle als Objekt der Herrschaft. Und bedenkt man, was es damals für Frauen bedeutete, in der Politik mitreden zu wollen und öffentlich zu demonstrieren, so ist es in der Tat angebracht, voller Anerkennung der Anstifterin zum Widerstand Barbara Walch-Künkelin zu gedenken“. Und genau dies tut die Stadt Schorndorf mit diesem ausdrucksstarken Mosaik am Rathaus. Bei genauerem Betrachten des Mosaiks, können die Emotionen in den Gesichtern der dargestellten Personen gut wahrgenommen werden. Links die Weiber von Schorndorf, rechts die Herren des Magistrats und in der Bildmitte, im dargestellten Fenster, die empörte Bürgerschaft. Wie der Künstler Stockhausen bei der Enthüllung des Kunstwerkes hervorhob, habe er die Schorndorfer Stadtheldin Barbara Künkelin bewusst nicht wie sonst üblich mit dem Schwert in der Hand dargestellt. „Eine rechte Frau“, so Stockhausen, „brauche eine solche Waffe nicht, sie könne sich auch so durchsetzen“.
Wie wir weiter erfahren, wird seit 1982 der „Barbara-Künkelin-Preis“ alle 2 Jahre an Frauen verliehen, die Mut bewiesen haben, sich zu wehren, Missstände aufzuzeigen und unbequeme Wahrheiten auszusprechen. So war zum Beispiel die bekannte Fernsehmoderatorin Dunja Hayali die Preisträgerin 2021. Doch zurück zur Stadtgeschichte. Es wüteten nochmals zwei große Brände: 1690 in der oberen Stadt, wo über 75 Gebäude verwüstet wurden. Und 1743, wo dann die ganze Weststadt mit über 125 Häusern abgebrannt ist. Danach wurde eine Verordnung erlassen, wonach keine Häuser mehr mit sichtbarem Fachwerk gebaut werden durften.
Nun erfolgte wieder ein Zeitsprung in die neuere Zeit, und wir richteten unseren Blick auf den weithin sichtbaren Postturm und lauschten wieder den Informationen. Die Geschichte des Postturms reicht bis in die 30er Jahre zurück. Seit damals steht zwischen dem Bahnhof und dem Marktplatz in Schorndorf der alte Postturm. In diesem waren früher die Telefonvermittlung der Reichspost und „das Fräulein vom Amt“ untergebracht. Der Turm war ursprünglich achtgeschossig und 34 Meter hoch. In den vergangenen Jahren stand dann der schmucklose Bau leer und wurde von 2009 bis 2010 zurückgebaut, was die Schorndorfer Bevölkerung wohl sehr freute. Doch diese Freude verflog ganz schnell, als bekannt wurde, dass stattdessen nun ein Neubau mit 12 Geschossen gebaut werden solle, die über einen gläsernen Panoramaaufzug miteinander verbunden werden. Die Sanierung und der Neubau erfolgten bis 2013. Der neue Turm ist nun knapp 45 Meter hoch. Alt und neu wurden miteinander verbunden: Der neue Postturm, der moderne Schulterbau und die zwei Altbauten. Heute befinden sich im neuen Postturm-Carré Einzelhandelsflächen, Büros, Praxen und eine Sky Bar in den beiden oberen Stockwerken. Diese soll wunderschön und der Ausblick von dort oben traumhaft sein. Außerdem ist dies auch eine offizielle Außenstelle vom Standesamt Schorndorf.
„So, jetzt ganget m’r weiter in’d Höllgass, in mei Geburtshaus!“, sprach Walter Leppert alias Gottlieb Daimler. Dort angekommen, wurde zunächst ein Gruppenbild gemacht. Und damit befanden wir uns nun im Anfang des 19. Jahrhunderts. „In Deutschland ging nichts voran“ wurde uns gesagt. Im ganzen Land gab es Hungersnöte; der Südwesten war dabei besonders gebeutelt. Und dann kam noch der fürchterliche Vulkanausbruch des Tambora in Indonesien. Vulkanasche und Aerosole stiegen 42 Kilometer in die Atmosphäre hoch, verteilten sich dort weltweit und verfinsterten den gesamten Globus. Dies verursachte einen dramatischen Temperaturrückgang. Der Frühling hatte gerade begonnen, da kehrte der Schnee zurück. In Regionen wie Württemberg und auch der Schweiz hörte es über Monate kaum mehr auf zu regnen oder zu schneien. Und auf Tauwetter folgten dann extreme Hochwasser. Das Jahr 1816 ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts nahm ihren Lauf. Unzählige Menschen in Europa verhungerten, weil auf den Feldern kaum etwas wuchs. Die Folgen waren Missernten, Hunger und Seuchen.
Dies war der Übergang zu Informationen über das Cannstatter Volksfest, beziehungsweise wie es damals hieß, das „Landwirtschaftliche Hauptfest“. In Zeiten politischer Wirren und wirtschaftlicher Schwäche legt der württembergische König Wilhelm I. mit der Gründung der "Zentralstelle des landwirtschaftlichen Vereins" 1817 den Grundstein für das, was wir heute als Cannstatter Volksfest kennen. Nach dem Wunsch des Königs sollte ein landwirtschaftliches Fest mit Pferderennen, Preisverleihungen für herausragende Leistungen in der Viehzucht, zusammen mit einem allgemeinen Volksfest die schwer geschädigte Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Bereits beim ersten Volksfest 1818 gab es eine hoch aufragende Säule, die mit vielen Früchten, Getreide und Gemüse geschmückt war. So erinnert dieses Symbol, die Fruchtsäule, noch heute an den Ursprung des Volksfestes als landwirtschaftliches Fest.
Von der Hölle des Vulkanausbruchs wurde nun wieder der Bogen zur „Höllgasse“ gespannt, wo wir ja gerade standen. Der Name „Höllgasse“ lässt sich bis ins Jahr 1690 zurückverfolgen und bedeutete „helle Gasse“. Wir sind jetzt wieder im Jahre 1834. Die Stadt hatte wieder 4.000 Einwohner, außerdem 26 Bäckereien und 48 „Wein-Wirtschäftla“, was uns – genau wie bei der nächsten Erklärung - schon etwas lächeln ließ: Angeblich ging es damals ja oft so zu: „Eugen, gang a mal naus und dua die Henna rei“. „Ja, und no isch ma halt nach zwoi Stonda wiederkomma und hat scho drei Viertala dronka ghet.“
In diese Zeit hinein wurde hier in der Höllgasse 7 am 17. März 1834 im 1. Stock Gottlieb Daimler als zweiter von vier Buben geboren. Die Eltern haben hier eine Bäckerei und die Weinwirtschaft „Zum Pfauen“ betrieben. Der Bub Gottlieb wuchs hier auf und ging hier auch zur Schule. Er hatte einen 19 Jahre älteren Cousin, den Gotthilf Wilhelm, einen angesehener Oberamts-Geometer. Dieser war kinderlos, und hatte immer gesagt, er kümmere sich um den Gottlieb; seine Eltern hätten ja genug mit den anderen 3 Buben und dem Geschäft zu tun. Dieser Cousin hat schon sehr früh erkannt, was in dem Buben, dem Gottlieb, für Potenzial steckt.
Hier in der Höllgasse waren die ganzen Handwerksbetriebe angesiedelt. Da ist der Gottlieb immer wieder in diesen Handwerksbetrieben „rumgedengelt“. Er war sehr introvertiert, hat 14-jährig im Jahr 1848 seine Mittlere Reife mit Auszeichnung abgelegt. Dann kam natürlich die Frage: „Was soll der Kerle jetzt macha?“ Die Eltern hätten es ja gern gesehen, wenn Gottlieb auch einen Beamten-Beruf erlernt hätte. Aber sie hatten dann Bedenken, weil die Zeit nicht so gut war und man nicht wissen konnte, wie es weitergeht. Und so dachten sie, wir fragen mal lieber im Nachbarhaus an. Dort betreibt der Büchsenmachermeister Hermann Raithel sein Geschäft. So ließ sich Gottlieb Daimler zum Büchsenmacher ausbilden. 1852 beendete er die Ausbildung mit der Gesellenprüfung. Eine Nachbildung seines Gesellenstückes konnten wir im Museum des Geburtshauses besichtigen: Eine doppelläufige Taschenpistole mit gezogenem Lauf. Die Beschläge und der Knauf der Pistole sind fein ziseliert und brüniert.
Nach seiner Gesellenzeit war es wieder der Cousin, der sagte, Gottlieb, jetzt gehst du auf eine weiterführende Schule, auf die Polytechnische Schule, nach Stuttgart. Dort haben die Lehrer dann den damaligen Wirtschaftsweisen Ferdinand von Steinbeis auf den jungen Schüler aufmerksam gemacht. Dieser hat sich den Gottlieb angeschaut und dann gesagt „Gottlieb, wenn das Jahr um ist, nehme ich dich unter meine Fittiche“. So war es denn auch. 1853 begann er durch dessen Vermittlung im elsässischen Graffenstaden in einem Maschinenbauunternehmen, welches vor allem Eisenbahnbedarf herstellte, zu arbeiten. 1857 verließ er die Firma und begann in Stuttgart an der Polytechnischen Schule ein Maschinenbaustudium. Physik und Chemie, Maschinenbau, Geschichte, Volkswirtschaft und Englisch stehen auf dem Stundenplan. Elektrotechnik allerdings fehlt noch. 1859 kehrt er nach Graffenstaden zurück, aber er kann sich für den Lokomotivbau nicht mehr so recht erwärmen. Doch er hat inzwischen die französische Sprache erlernt und von da an auch perfekt beherrscht. Er verlässt das Werk und Steinbeis hat ihn nach Paris in eine Bandsägen Fabrik und anschließend 2 Jahre nach England geschickt. Dort hat er sich in verschiedenen Unternehmen weiterentwickelt, aber auch zum ersten Mal heimgeschrieben, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ginge. Er hätte Herzprobleme und müsse immer wieder zu den Ärzten. So hat er sich denn auch 1873 von seinem Förderer Steinbeis getrennt und kam zurück. Es war ihm einfach alles zu viel, und vor allem wollte er ja auch kein Lokomotivenbauer werden
Die Firma Straub & Schweizer (heute WMF) hatte damals eine Führungspersönlichkeit gesucht. Und der junge Straub, der Daimler als Studienkollege kennengelernt hatte, empfahl seinen Eltern, den Daimler zu nehmen, weil dieser ein super „Beißer“ sei. Und so hat Daimler ab 1862 für 3 Jahre dort gearbeitet. 1865 wurde ihm dann die Leitung der Bruderhaus-Maschinenfabrik in Reutlingen übertragen, wo er zum ersten Mal mit Wilhelm Maybach zusammentraf. Der um 12 Jahre jüngere Wilhelm Maybach hatte als Vollwaise im Bruderhaus Zuflucht gefunden. Dort fällt er durch sein hohes technisches Verständnis, seine hervorragenden Leistungen und durch seinen Erfindergeist auf. Dann folgte für Daimler privat ein besonderes Ereignis: 1867 heiratete er die Apothekerstochter Emma Pauline Kurtz, mit der er später 5 Kinder hatte.
Als Daimler 1868 als Vorstand der Werkstätten zur stark expandierenden Maschinenfabrik Karlsruhe, die vor allem Eisenbahnmaterial herstellt, wechselt, nimmt er Maybach mit. Das Duo wird von nun an bis zu Daimlers Tod im Jahre 1900 unzertrennlich bleiben. Danach ein weiterer Wechsel: Die beiden Inhaber der Gasmotorenfabrik Deutz, der Ingenieur Gustav Langen und der Erfinder Nikolaus August Otto, erweitern die wirtschaftliche Basis ihrer Fabrik und machen daraus eine AG. Grundlage der Tätigkeit ist eine atmosphärische Gaskraftmaschine Ottos. Langen wünscht sich für die Werkstätten und das Zeichenbüro einen erfahrenen Betriebsleiter, und zwar eben Gottlieb Daimler. Maybach wird Leiter der Konstruktionsabteilung und tritt seinen Dienst am 1. Juli 1872 an. Daimler folgt einen Monat später und hat, wie uns „unser Daimler“ erzählte, dabei sehr viele verlässliche Mitarbeiter mitgenommen.
Zitat unseres Stadtführers: „In Köln haben sie Angst bekommen. Da kommt einer aus dem Schwabenland. Da kommt der Daimler, der baut hier ein Schwabennest. Die Schwaben sind doch so klug!“ – Und er zitiert ein Gedicht des früheren Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommels:
„Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel.
Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel!
Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft.
Mit Butter wirkt sie fabelhaft.
Erleuchtet mit der Weisheit Fackel,
den Verstand vom größten Dackel!“
Wir mussten alle kräftig lachen und applaudierten unserem Stadtführer, der uns seine Informationen immer wieder in so humorvoller Weise vermittelte. Danach ging es dann sachlich weiter mit den Ausführungen zu seiner von ihm dargestellten Person: Der Daimler war sehr geschätzt in Köln, weil er sehr viel erreicht hat in der Fabrikation. Er war sehr viel in Amerika, auf Weltausstellungen, überall hat er die Firma vertreten, hat neue Patente angemeldet. War auch ein paar Monate in Russland. Dann kam es jedoch zur Trennung, denn er kam mit seinen Vorstellungen nicht weiter. Er wollte ja die Kölner davon überzeugen, dass diese von ihren großen schweren Turbinenmotoren wegkommen und sich stattdessen auf mit Benzin betriebene Leichtlaufmotoren konzentrieren sollten. Auf Motoren, die überall einsetzbar waren, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und damit erklärte sich uns auch das Aussehen des uns allen ja bekannten Mercedes-Stern. Die drei Zacken stehen sinnbildlich eben genau dafür: Mercedes zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und stolz präsentierte uns „unser Daimler“ seinen Mercedes-Stern.
Daimler habe viel Geld bekommen, weil er die Firma so vorwärtsbrachte. Er war dann immer wieder im Kurpark in Stuttgart, um sich ein wenig zu erholen. Damals zog die Stadt am Neckar mit ihren Heilquellen Badegäste aus der ganzen Welt an. Auch das Cannstatter Wasser habe Daimler wohl geschmeckt und gut getan.
Nach Differenzen mit der Geschäftsleitung verließ Daimler Mitte 1882 Deutz. In Cannstatt in der Taubenheimstraße erwarb er eine Villa für 75.000 Goldmark. Aber nicht die Villa war der Hauptgrund für diesen Kauf, sondern das sich im großen Garten der Villa befindliche Gewächshaus. Dieses ließ er umgehend durch einen Backstein-Anbau vergrößern, um dort eine Versuchswerkstatt einzurichten.
Im Gartenhaus führte Gottlieb Daimler nun mit Wilhelm Maybach, der mit ihm gemeinsam von Deutz nach Cannstatt gegangen war, die ersten Versuche für den schnellaufenden, kleinen Verbrennungs-motor aus. Sein grundlegender Ansatz war, Benzin als ausschließlichen Brennstoff für die Motoren zu verwenden und diese in alle nur denkbaren Fahrzeuge - zu Lande, zu Wasser und in der Luft - einzubauen.
Die Versuche liefen unter größter Geheimhaltung, denn Gottlieb Daimler hatte Angst, dass seine Idee der Konkurrenz bekannt werden könnte. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach entwickelten bis 1883 den ersten schnellaufenden Viertaktmotor. Damit verwirklichte Gottlieb Daimler seine Vision von einem universell einsetzbaren Antrieb und veränderte quasi die Welt der Mobilität.
Und noch eine Geschichte mit dem Thema „Geheimhaltung“ durften wir erfahren: Nachdem es Daimler und Maybach gelungen war, einen kleinen, leichten und schnelllaufenden Motor zu entwickeln, der so leicht aber gleichzeitig so stark war, dass er ein Fahrzeug antreiben konnte (die sog. „Standuhr“) und auch schon in einem Laufrad erfolgreich eingesetzt worden war, hatten die erfolgreichen Konstrukteure weitere Pläne. Und um diese zu verwirklichen, bestellte Daimler bei der renommierten Wagenbaufabrik „Wilhelm Wimpff & Sohn“ im März 1886 eine Kutsche. Bedingung war jedoch, wie wir erfuhren, dass die Kutsche nach Fertigstellung heimlich bei Nacht und ohne Deichsel angeliefert werden müsse. „Ja, schiebet denn bei Ihna die Gäul‘ die Kutscha von hinta?“ sei die erstaunte Frage von Wimpff gewesen. Und auf die Nachfrage, warum alles heimlich erfolgen müsse, erklärte ihm Daimler, dass es sich hierbei um ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau Emma handeln würde, und somit eine Überraschung sein solle.
Doch dieses Geburtstagsgeschenk hat die Emma Daimler nie erhalten. Denn als die Kutsche dann in der Nacht des 28. August angeliefert wurde, ließen Daimler und Maybach einen Motor einbauen, der noch stärker war als jener im Vorjahr entwickelte. Ihre „Motor-Kutsche“ ist somit das weltweit erste Automobil auf 4 Räder und mit einem Benzinmotor. Mit einem Hubraum von 462 Kubikzentimetern erzeugt er bei 650 Umdrehungen pro Minute 1,1 bis 1,5 PS und bringt die Motor-Kutsche auf eine Höchstgeschwindigkeit von 18 Kilometer in der Stunde. Ein Nachteil dieser Motor-Kutsche war jedoch ihre Drehschemel-Lenkung, die nur minimale Kurvengeschwindigkeit erlaubte und vom Chauffeur eine starke Kraftanstrengung erforderte.
Nun kam unser Führer noch auf die Themen „Jellinek“ und „Mercedes“ zu sprechen. Wir erfuhren, dass Jellinek ein Geschäftsfreund von Daimler war. Er war österreichischer Generalkonsul in den südamerikanischen Staaten und hatte eine Tochter mit dem schönen Namen Mercedes. In Nizza begeisterte sich Jellinek für Autorennen. Er bewunderte die Arbeit von Maybach und versprach, eine Lieferung von 36 Autos für 550.000 Goldmark zu kaufen, wenn Maybach nach seinen Vorgaben einen großartigen Rennwagen für ihn entwerfen könnte. Der Prototyp wurde im Dezember 1900 fertiggestellt und mit ihm hatte Jellinek 1901 eine Reihe von Rennerfolgen. Jellinek vertrat die Ansicht, dass Rennwagen einen Namen brauchen. Und der Name Mercedes sei so melodisch, dass er ihn gleich für Daimler festschreiben ließ. An dieser Stelle betonte „unser Daimler“ dann: „Ich sage immer: Wo Mercedes draufsteht, ist immer Gottlieb Daimler drin!“.
Am 28. Juli 1889 verstarb Emma Daimler und 1893, am 8. Juli, heiratete Gottlieb Daimler seine zweite Frau Lina Hartmann, geb. Schwend. Die Hochzeitsreise führte nach Chicago und wird von Daimler zu einem Besuch der dortigen Weltausstellung genutzt. Denn dort präsentiert die Daimler-Motoren-Gesellschaft das erste betriebsfähige Automobil, das in den USA öffentlich gezeigt wird. Ausgestellt ist eine modifizierte Version des "Stahlradwagens". Bei dieser Information gibt es für uns wieder einen kleinen humoristischen Einschub mit Blick auf die im Museum ausgestellte Handtasche. Denn diese gefiel Gottlieb Daimler wohl gar nicht, und deshalb sagte er zu seiner Lina: „Mit dera wüschta Handtasch‘, die du hasch, kannsch du aber net verroisa. Du musch dir obedingt a neue kaufa!“ Mit einem Schmunzeln verließen wir dann auch wieder das kleine, aber durchaus interessante Museum im Geburtshaus in der Höllgasse 7.
Als wir vor die Türe treten, stellen wir fest, dass es erneut ganz leicht zu regnen beginnt. Also Schirme raus und aufgespannt. Gespannt waren wir auch, wohin uns die nächsten Schritte nun führen sollten. Zunächst kamen wir am Spitalgebäude vorbei, wo wir wieder einige interessante Informationen erhielten. Das Gebäude wird um 1420 zum ersten Mal erwähnt. Das Spital war kein Hospital, wie der Name zunächst vermuten lassen könnte, sondern bot damals den alten und betagten Leuten, vor allem den reichen Bauersleuten, die keine Erben oder Nachkommen hatten, die Chance, sich hier ein sorgenfreies Leben zu erkaufen. Durch Einbringen eines Legats sicherten sie sich damit eine dauernde Unterkunft und Pflege. Man nannte diese Personen damals auch Pfründner.
Das Spital zum Heiligen Geist wurde wahrscheinlich vor 1420 von der Stadt Schorndorf als Altersheim und Waisenhaus gegründet und verstand sich als Wirtschaftsunternehmen, welches sein Vermögen unter anderem auch durch Geldverleih vermehrte. So lieh es beispielsweise 1464 dem Landesherrn die hohe Summe von 1000 Gulden gegen alle Rechte an dem Dorf Weiler bei Schorndorf. Das Spital hatte zahlreiche Güter im Remstal und bei Ludwigsburg erworben. Auch fünf der sechs Schorndorfer Groß-Keltern gehörten dem Spital. Im Nebenhaus des Spitals befindet sich das Stadtarchiv, welches, wie uns gesagt wurde, noch viele Originale ab 1368 oder auch eine Urkunde des Spitals von 1539 in seinem Besitz hat. Aber das meiste ist natürlich heute auch schon digitalisiert.
Und dann sind wir am Schloss angekommen, von dem wir erfahren, dass es ganz früher vermutlich ein Wasserschloss war. Unter Herzog Ulrich wurde es ab 1538 erbaut und sollte als Landesfestung dienen. So war das Schloss Eckpfeiler der Stadtfestung und überdauerte alle Katastrophen, selbst die Feuersbrunst von 1634, der ja ansonsten fast die gesamte Stadt zum Opfer fiel.
Wir sehen die mächtigen Rundtürme dieser trapezförmigen, vierflügeligen Anlage und später auch das Fachwerk des relativ kleinen, rechteckigen Innenhofes. Aber auch der Gusserker, oder auch „Pechnase“ genannt, über dem Hauptportal ist interessant. Hier konnten unliebsame Besucher oder Angreifer dann von oben mit siedendem Wasser, Öl, Pech oder auch flüssigem Blei übergossen werden. Aber man weiß auch, wie uns erklärt wurde, dass unter diese Pechnase auch Verurteilte gestellt und dann „geteert und gefedert“ wurden.
Ebenfalls über dem Eingangstor und unterhalb des Gusserkers ist das Wappen von Herzog Ulrich zu sehen. Es zeigt die Stangen von Württemberg, seinen Jagdhund, seine beiden Jagd-Hüte, rechts die Rauten von Kirchheim u.T., links das Stadtwappen von Markgröningen (weil Markgröningen in der württ. Geschichte immer eine große Bedeutung hatte) und rechts die beiden Barben von Mömpelgard. Heute hat im Burgschloss das Amtsgericht Schorndorf seinen Sitz.
Nun gab es für uns wieder einen Zeitsprung in das Jahr 1511: Am 2. März 1511 feierte Herzog Ulrich die Hochzeit mit Sabina von Bayern. Das Fest wurde mit großem Pomp und mehr als 7.000 Gästen gefeiert und dauert 14 Tage. Rund um das Stuttgarter Schloss wurden die Bürger kostenlos gespeist. Und dies alles, obwohl der Herzog eigentlich schon lange kein Geld mehr hatte. Und weil 1515 die herzoglichen Kassen wieder mal ganz leer waren, ging der Herzog zum Landtag nach Tübingen und wollte erreichen, dass eine Reichensteuer eingeführt wird. Als der Landtag dies jedoch verweigerte, kam ihm der Gedanke einer „Ernährungssteuer“. Für alles, was die Bauern auf den Märkten verkaufen, müssen diese dann Steuern abliefern. Doch diese ließen sich dies nicht gefallen und beschlossen, künftig sonntags nicht mehr zu den Huldigungen zu gehen. Stattdessen haben sie einen Aufstand gegründet, der in die Geschichte als der Aufstand des „Armen Konrad“ eingegangen ist.
Wir werden noch auf die Figur des Peter Gais (dem Gaispeter) hingewiesen, der ja damals die Sache mit dem „Gottesurteil“, der sogenannten Wasserprobe inszenierte. Hintergrund war: Weil der Herzog Schulden hatte, beschloss er im Frühjahr 1514, eine neue Steuer auf Fleisch einzuführen. Zum 1. Mai ließ er neue Gewichte ausgeben, die rund 10% leichter waren als die alten. Begründet wurde das damit, dass die Gewichte vereinheitlicht werden müssten. Fleischwaren wurden nun von einem Tag auf den anderen 10% teurer. Oder für den gleichen Preis erhielt man beispielsweise statt eines Kilogramms Mehl nur noch 700 g. Die Untertanen des Herzogs waren über diese Steuererhöhung empört und die Art und Weise, wie sie durchgesetzt werden sollte. Einer von ihnen war eben jener Beutelsbacher Taglöhner Peter Gais, genannt Gaispeter.
Neunzig Jahre später schreibt Oswalt Gabelkover in seiner Chronik, dass der Gaispeter mit seinen Anhängern in der Metzgerei erschienen sei und die neuen Gewichtssteine mitgenommen habe. Mit Trommeln und Pfeifen seien sie dann zur Rems gezogen, wo Gaispeter die Gewichte in den Fluss warf und eine „Wasserprobe“ inszenierte: Wenn die Herrschaft Recht hätte, dann würden die Steine empor schwimmen, wenn die Bauern im Recht seien, dann würden die Gewichte auf den Grund fallen und sich nicht mehr sehen lassen. Wie zu erwarten war, gab das Gottesurteil den jubelnden Bauern recht. Die Obrigkeit forderte anderntags die Rückgabe der Steine. Der Gaispeter konnte oder wollte sie nicht wieder beibringen, sondern eskalierte die Situation noch, indem er in der Kapelle Sturm läutete und den zusammenkommenden Bauern erklärte, er sei der „Arme Konrad“, was damals wohl auch ein Synonym für den einfachen Mann war und zudem für jemanden stand, der „koan Rat“ mehr wusste. Eine immer größer werdende Schar von Aufrührern zog vor Schorndorf, wo sie zwar wenig ausrichteten, aber Herzog Ulrich so beeindruckten, dass er die ungeliebte Steuer aufhob. Der Aufstand wurde letztlich niedergeschlagen und in Stuttgart wurden 10 Anführer geköpft. Der Bildhauer und Künstler Christoph Traub hat zur Erinnerung 10 Stelen aus Stein geschaffen, die seit 2014 an der Stadtkirche stehen.
Wir erfahren, dass der Herzog wie bisher weitergemacht hat. Er hat dann 1519 die Reichsstadt Reutlingen überfallen. Daraufhin wurde er vom Kaiser nach Mömpelgard verbannt. 16 Jahre war er dort. In dieser Zeit hatten die Habsburger die Regentschaft in Württemberg Grund: Die Mutter der Sabina von Bayern war Österreicherin, Habsburgerin. Im Exil wandte sich Herzog Ulrich bereits ab etwa 1523 der Reformation zu, und 1527 fand er Zuflucht bei dem ebenfalls protestantischen Landgrafen Philipp I. von Hessen in Kassel bzw. Marburg. Wir erfahren dann noch, dass der Herzog mit Hilfe seines Cousins in der Schlacht bei Lauffen im Jahr 1534 sein Land zurückerobern konnte. Mit dem Sieg von 25 000 Hessen gegen 10 000 Österreicher bei Lauffen errang Ulrich nicht nur die Macht wieder, sondern etablierte auch die Reformation in Württemberg.
Mit diesem letzten Ausflug in die wechselhafte Geschichte Württembergs ging unsere Stadtführung zu Ende. Und unser Stadtführer schloss seine Ausführungen mit diesem Schlusssatz, den Sie ja schon als Überschrift lesen konnten: „Stadtführung für jedes Alter macht viel Freude mit Lepperts Walter“. Beide Stadtführer verabschiedeten sich dann von uns und Frieder Rutte bedankte sich bei beiden für die vielen interessanten Informationen, die wir bei den Führungen erhalten hatten, und dass es uns hier in Schorndorf, in Daimlers Geburtsstadt, sehr gut gefallen hat. Nun hatten wir noch etwas Zeit, uns noch einmal selbst etwas umzuschauen, hier oder dort eine Tasse Kaffee zu trinken oder sich ein leckeres Eis zu gönnen. Bereits bei der Rückfahrt im Zug wurde in vielen Gesprächen untereinander noch einmal das Erlebte und Gesehene ausgetauscht. Dabei waren wir uns alle einig, dass dies ein sehr schöner, informativer und erlebnisreicher Tag war. Den beiden Organisatoren von unserem ASP-Team, Monika Lang und Frieder Rutte, gebührt daher unser großer und herzlicher Dank. Ihr Beiden habt was Tolles ausgesucht, sehr gut vorbereitet und auch prima organisiert. Und so hat sich auch diesmal wieder aufs Neue bestätigt: „Mit’m ASP isch’s oifach schee!“
Text: Horst Neidhart
Bildgestaltung: Rolf Omasreither

Um 10 Uhr trafen sich 15 gut gelaunte und motivierte Radler zur Radtour 2022. Treffpunkt Marbach direkt am Steg über den Neckar. Einige kamen schon von Ihrem Wohnort mit dem Fahrrad und hatten somit sich schon mal „warm geradelt“.
Auch unser Begleitteam war vor Ort und startklar. Natürlich bestens vorbereitet und ebenfalls hoch motiviert.
Nach kurzer Begrüßung und technischer Einweisung (Verhalten beim Radfahren in einer Gruppe) ging es los.
Zuerst auf dem Neckartalradweg (der alten Bahntrasse, wo zu früheren Zeiten der sogenannte „Entenmörder“ / Dampflok fuhr. Entlang der Murr Richtung Steinheim und anschließend der Bottwar Richtung Großbottwar. Vorbei am Naturschutzprojekt mit den Wasserbüffeln, durch die „Stadt am Bach“ (naturnaher Spielplatz) zur ersten Getränkepause. An einem schönen, schattigen Platz mit Bänken und großen Bäumen, wo bereits unser Verpflegungsteam auf uns wartete. Während der Pause genossen alle die schöne Aussicht auf die umliegenden Höhen (Wunnenstein mit Turm, Köchersberg, Forstkopf und das Winzerhäuser Tal) und natürlich die Unterhaltung miteinander.
Dann ging es durchs Winzerhäuser Tal mit Wiesen, Äckern und alten Obstbäumen zum Holzweiler Hof und Richtung Ottmarsheimer Höhe. Ebenfalls durch großflächige Obstplantagen und Weinberge. Immer ein schönes Panorama im Blick. Der rückwärtige Blick auf die Berge, Burgen des Bottwartals und die Löwensteiner Berge. In die andere Richtung weit ins Land.
Mitten in den Weinbergen von Mundelsheim trafen wir erneut mit unserem Verpflegungsteam zusammen, die bereits alles für die Mittagspause vorbereitet hatten. Natürlich wie gewohnt und traditionell mit kulinarischen Highlights, passend zur tollen Aussicht und Panorama auf die Neckarschleife bei Hessigheim, Mundelsheim, dem Schreyerhof. Zudem gab es noch ein paar historische Infos zum „Lügenbrüggle“ und zum „Galgenbaum“ von Mundelsheim. Die Weitsicht war an diesem Tage perfekt. Wir konnten sogar in weiter, weiter Ferne die Teck sehen.
Alle waren sich einig: perfekte Aussicht, perfektes Panorama, perfektes Essen. Mehr wird nicht verraten. Einfach nächstes Jahr mit radeln.
Damit nicht genug. Unser Weg führte uns weiter durch die Weinberge vorbei an den Felsengärten. Links oben die Felsen, an denen die Kletterer ihre Herausforderung finden und rechts unten der Neckar mit seinen Schleifen. Es war einfach toll und wir mittendrin in den Weinlagen.
Es ging nun weiter bergab zum Neckarufer und an jenem entlang nach Hessigheim, Mundelsheim, Pleidelsheim, Beihingen immer dicht am Neckar. An den Steillagen von Benningen vorbei und über den Neckarsteg zum Ausgangspunkt und anschließend zum wohlverdienten Ausklang im Biergarten. Eine tolle Tour und vor allem unfall- und pannenfrei!!!!!
Wir freuen uns alle auf die Radtour 2023. Hoffentlich haben wir euch ein bisschen motiviert und neugierig gemacht.
Tschüss! Bis bald! Und bleibt gesund!
Das ASP-Rad-Team
Tourenführung: Axel Fink, Heinz Zeyhle, Ullrich Bertsch
Verpflegungsengel: Petra Benub, Werner Knoll, Reinhard Fröhlich, Friedrich Rutte
….. und natürlich die sehr motivierten Radler
Bericht: Axel Fink
Bildgestaltung und Homepage: Rolf Omasreither

„Haben Sie einen Vogel?“
Als uns Emilie Wagner diese Frage stellte, waren wir keineswegs beleidigt, sondern brachen in lautes Gelächter aus. Doch wer ist Emilie Wagner, und warum stellte sie uns diese – auf den ersten Blick -doch sehr zweideutige Frage?
Nun, das ist schnell erklärt: Emilie Wagner heißt im normalen Leben Gabriele Stadler und unternahm mit uns in der Person der Fabrikantengattin Emilie Wagner einen Stadtspaziergang durch Ludwigsburg anno 1900. Und für diese Veranstaltung unseres ASP-Teams hatten sich 36 ehemalige Kolleginnen und Kollegen angemeldet. Die erfreulich hohe Zahl der Anmeldungen führte dazu, dass die Organisatorin dieses Events, unsere Kollegin Anne Tschürtz, zwei Gruppen bilden musste, welche sich dann am 24. bzw. am 31. August morgens um 10.15 Uhr an der Musikhalle trafen.
Bei beiden Gruppen war die Freude über das Wiedersehen groß. Hatten sich doch manche unter uns schon längere Zeit nicht mehr gesehen. So gab es natürlich auch wieder viel zu erzählen. Ein Gläschen Sekt und die frische Brezel gab es als kleinen Willkommensgruß und es dauerte nicht mehr lang, da kam auch schon eine elegant gekleidete Dame auf uns zu und stellte sich als eben jene Emilie Wagner vor.
Schon ihre Begrüßungsworte zeigten uns, dass wir es mit einer sehr charmanten und humorvollen Persönlichkeit zu tun hatten. Wir erfuhren, dass sie die Witwe des verstorbenen Fabrikanten Fritz Wagner ist und ihr Sohn Hans nun die Firma Wagner & Keller übernommen hat. Wie sie voll Stolz berichtete, sei ihr Sohn „ein ganz schlauer Kopf“, der eine Maschine, einen „Jenseits-Apparat“ erfunden habe. Diese Maschine kann Draht ziehen und daraus stellt die Firma wunderbare Vogelheime her. Daher also auch ihr Interesse daran, wer von uns denn einen Vogel daheim habe. Denn in dieser Zeit anno 1900 haben sich sehr viele Haushalte Vögel, vor allem Singvögel, gehalten.
Dass es sich bei den von ihr angesprochenen „Vogelheimen“ aber nicht um schlichte Vogelkäfige handelt, zeigte sie uns dann anhand einiger Bilder. Voll Stolz betonte sie dabei: „Diese wunderschönen, phantasievollen Gebilde werten jedes Eigenheim auf. Und ich bin mir sicher, dass man noch in 100 Jahren unsere Firma kennt!“. Wie recht sie doch hatte, denn vielen unter uns ist die Firma Wagner & Keller tatsächlich noch ein Begriff.
Nachdem jedoch feststand, dass keiner von uns „einen Vogel hat“, lädt uns Emilie Wagner zu einem Spaziergang durch die schöne Stadt Ludwigsburg ein, wo nach ihren Aussagen in den letzten 50 Jahren (Anmerkung: wir sind ja 2 Jahre vor der Jahrhundertwende) viel passiert sei. Wie wir erfahren, hat es mit dem aufstrebenden Ludwigsburg mit dem Bahnhof begonnen. Und schon wieder eine direkte Frage an uns: „Haben Sie auch schon einen Bahnhof?“. Da sie von uns sowieso keine bejahende Antwort erwartete, fuhr sie in ihren Ausführungen auch gleich fort. Voll Stolz erzählte sie uns, dass der Zug 4-mal am Tag von hier nach Stuttgart fahre und dafür nur eine halbe Stunde benötige.
Der Bahnhof wurde 1846 eingeweiht. Doch im Gegensatz zu Esslingen, wo die Einweihung des dortigen Bahnhofs von der Stadt und ihren Bürgern richtig gefeiert wurde, berichtete sie uns ganz empört, dass in Ludwigsburg dagegen absolut nichts los gewesen sei. Und damit kam sie auf den damaligen Stadtschultheiß Karl Friedrich Bunz zu sprechen. Dass dieser – im Gegensatz zu seinem Nachfolger, Heinrich von Abel - jedoch nicht ihr Freund war, konnten wir ihren folgenden, hoch emotionalen Ausführungen leicht entnehmen. „Das war ein sehr phlegmatischer Mensch, der nur in die Pötte kam, wenn’s um ihn ging“, ereiferte sie sich.
Wir erfahren dann noch mehr über die Schwierigkeiten von der Planung bis zur Fertigstellung des Bahnhofes. Zur Einweihung hatte König Wilhelm I. alle Honoratioren nach Stuttgart ins Marquardt eingeladen. Schultheiß Bunz jedoch war noch immer beleidigt und blieb daher fern, worauf der König sehr „verschnupft“ war.
Nun gut, der König hatte seinen Bahnhof, doch wie konnte das Zentrum der Stadt an den Bahnhof angebunden werden? Denn dadurch, dass in Ludwigsburg ja damals ein großes Sumpfgebiet war, musste das Gelände erst aufgeschüttet und ein riesiger Damm gebaut werden. Dies ist der Grund, weshalb der Bahnhof denn auch so weit weg vom Ortszentrum ist.
Wie uns die Führerin weiter erzählte, wollte man das Problem durch den Bau einer großen Holztreppe, die vom Matsch hoch zum Bahnhof führte, lösen. Emilie Wagner, die Seniorchefin von Wagner & Keller, ereiferte sich immer mehr. „Eine Holztreppe? Wie soll man denn da Waren zum Verschicken über die Holztreppe hochbringen? Wer hat sich denn das ausgedacht?“. Doch nach 10 oder 12 Jahren habe sich die Bahn erweichen lassen, eine Rampe zu bauen.
Voller Stolz erzählte sie uns dann vom Telegraphenamt und dass es in Ludwigsburg jetzt auch Telefon gibt. Und sie berichtet uns über ihre Schwierigkeiten mit der neuen Zeitbestimmung. Wir erfahren, dass am 12. März 1893 ja die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) eingeführt wurde. Vorher hatte in jedem Ort die jeweilige Ortszeit gegolten, die sich nach dem örtlichen Sonnenstand richtete. Wie man sich vorstellen könne, habe dies für die Zeitangaben in den Fahrplänen der Bahn schon zu größeren Problemen geführt, vor allem, wenn sich die Fahrstrecke über ein größeres Gebiet erstreckte.
Nun kam Emilie Wagner auf die Industrieansiedlung zu sprechen. Als Grund für die nur sehr langsame Ansiedlung größerer Industriebetriebe nannte sie noch einmal die Probleme mit dem Bahnhof, die ja immer noch nicht zur Zufriedenheit gelöst waren. Und sie zitierte einen Leserbrief (sowas gab’s demnach auch damals schon) aus der Ludwigsburger Kreiszeitung: „Eine Bahnlinie, die an der Stadt Ludwigsburg vorbeiführt, ist wie eine Regenwolke im dürren Sommer, die über die Stadt hinwegzieht ohne einen Tropfen fallen zu lassen, um sich jedoch dann woanders auf fruchtbare Weise zu entleeren.“
Und mit diesem Stichwort über das Wetter kam sie auf die größte Industrieansiedlung zu sprechen, die in Ludwigsburg bei entsprechender Wetterlage für ein besonderes „G’schmäckle“ sorgte. Wir wussten natürlich gleich, dass die Rede von Kaffee Franck war, der späteren Franck und Kathreiner GmbH.
Johann Heinrich Franck war ja zunächst in Vaihingen als Kolonialwarenhändler und Zuckerbäcker tätig und begann dort mit seinen Versuchen zur Herstellung von Zichorienkaffee. Als die Nachfrage stieg, verlegte er die Fabrikation nach Ludwigsburg. Hier wurden in den Jahren 1868 und 1869 große Neubauten geschaffen.
Nebenbei erfuhren wir dann noch, dass der uns allen bekannte und früher auch oft gebrauchte Name „Muckefuck“ eventuell eine Verballhornung des französischen Ausdrucks „Mocca faux“ für falschen Kaffee oder aber auch aus dem rheinischen „Mucke“ und „fuck“ für braunen Holzmulm und „faul“ kommen könnte. Anmerkung: Mulm ist das fasrig-bröckelige Endstadium der Holzzersetzung.
Und wir erfahren auch noch, dass sich die Familie Franck immer viele Gedanken um ihre Mitarbeiter machen würde und zudem auch immer wieder als Wohltäter für die Stadt Ludwigsburg auftrete. So hat Franck bspw. auch die Musikhalle spendiert, wo wir gerade stehen. Mit Franck nahm dann auch die weitere Industrialisierung in Ludwigsburg ihren Lauf.
Jetzt kam „Emilie“ aber ins Schwärmen. Voll Begeisterung erzählte sie uns von der neuesten Erfindung: der Gaslaterne. Und wir erfahren, dass ein Herr Schmid dort am Notbrunnen (am Feuersee) eine kleine Anstalt geschaffen hat, wo er „portables Gas“ in Behältern verkauft hat. Dies sei letztlich jedoch zu aufwändig gewesen und für die Gesamtversorgung auch unzureichend.
Damit kam unsere Führerin auf Louis Bührer zu sprechen, der sich ja immer intensiv in die Lokalpolitik eingeschaltet habe. Bührer gründete einen Aktienverein zur Finanzierung einer Gasanstalt. Bereits im Dezember 1858 konnte das Werk in Betrieb genommen werden, und im August 1860 übernahm die Stadt das Werk. Wobei es die Ludwigsburger angeblich ganz schlau gemacht haben, indem sie die Laternen immer an eine Kreuzung stellten und somit gleichzeitig zwei Straßen beleuchten konnten. Angeschaltet wurden die Laternen jedoch nur, wenn es wirklich dunkel war, und dies nur im Winter und nicht im Sommer, und auch nicht bei Vollmond. Also auch das Thema Energiesparen gab es damals schon!
Zwischenzeitlich stehen wir oben am Solitude-Parkhaus und werden hier nochmal auf die Höhe des aufgeschütteten Dammes hingewiesen, der nötig war, um den Bahnhof zu erreichen. Ludwigsburg hatte damals 5 Seen. Die Zisterzienser-Mönche aus Bebenhausen hielten sich da die Fische als Fastenspeise, während die württembergischen Herren hier dagegen die Jagd auf Wasservögel liebten. Und damit war Emilie Wagner beim Thema Wasser angelangt. Denn neben Gas war natürlich auch die Wasserversorgung für die Stadt sehr wichtig, schon wegen der Industrie und den vielen Dampfmaschinen.
So erfahren wir, dass der italienische Baumeister Frisoni den größten dieser Seen, den Feuersee, hatte einmauern lassen. Und wir erfahren auch, dass hier die Soldaten der Garnison das Schwimmen auf einem Schwimm-Floß erlernen mussten. Doch noch immer war die Wasserversorgung der Stadt nicht gewährleistet. Dagegen „plätscherte“ es jetzt richtig aus dem Mund unserer Führerin. Denn nun erfuhren wir, dass inzwischen Schultheiß Bunz verstorben ist. „Jetzt kommt mein großer Held: Bürgermeister Abel, ein junger, dynamischer Mann!“ sprudelt es nur so aus Emilie Wagner heraus.
Das neue Stadtoberhaupt machte nun die Wasserversorgung zur Chefsache. Er hatte einen Bruder, und dieser kannte den Ingenieur Karl von Ehmann, der damals die Alb-Wasserversorgung erfunden hatte. Und wir erfahren, dass Ehmann eine Pumpe mit 8 PS gebaut hatte, welche das Wasser von der Quelle am Feuersee zu einem Turm am Stuttgarter Tor pumpte. Und von dort oben konnten dann die Gebäude der Stadt mit Wasser versorgt werden. Die Kosten betrugen 9 Gulden im Jahr pro Abnehmer.
Unser Weiterweg führte uns über den Synagogenplatz zur Myliusstraße: Wir erfuhren, dass die jüdische Gemeinde damals 200 Mitglieder hatte. In der Myliusstraße angekommen, hatte Emilie Wagner wieder viele interessante Informationen für uns. So ist die Straße ja nach ihrem Gönner, dem General von Mylius benannt. Er hatte der Stadt für den Bau einer Straße, die zum Bahnhof führt, 8.000 Gulden versprochen Doch durch vielerlei Schwierigkeiten verzögerte sich der Bau und es kam zum Streit mit Mylius, der trotz mancher Bemühungen nicht beigelegt werden konnte. Am 23.04.1866 verstarb dann Mylius. Ursprünglich hatte er die Stadt zur Universalerbin seines Vermögens von 450.000 Francs eingesetzt. Aber einen Tag vor seinem Tod erstellte er ein neues Testament zu Gunsten seines Freundes Orville, und die Stadt Ludwigsburg wurde in diesem Testament überhaupt nicht mehr erwähnt. Auf Bitten der Stadt erklärte sich Orville dann jedoch bereit, der Stadt 10.000 Francs (entsprach ca. 5.000 Gulden) zu schenken unter der Voraussetzung, dass die Straße dafür nach ihrem Gönner Mylius benannt würde. Ende Oktober 1869 war die Straße dann endlich fertig. Emilie Wagner wies uns vor dem Weitergehen noch kurz darauf hin, dass das Besondere an dieser Straße ja ist, dass sie als erste Straße in Ludwigsburg als Diagonale zum ansonsten rechtwinkeligen Straßensystem geführt wird.
Danach standen wir vor dem uns allen bekannten Schillerdenkmal, welches von Ludwig von Hofer, der am 20.06.1801 in Ludwigsburg geboren wurde, aus Carrara-Marmor gefertigt wurde. Doch wieso steht das Schillerdenkmal eigentlich hier und nicht in Marbach? Auch hier lieferte uns die Führerin in ihrer humorvollen Art die Antwort, wonach Hofer das Denkmal im Andenken an seine in Marbach geborene Mutter der Stadt Marbach wohl angeboten hatte, diese jedoch kein Interesse dafür zeigte. Und so schenkte er es seiner Vaterstadt Ludwigsburg und wählte dafür als Standort den Wilhelmsplatz, der ja heute Schillerplatz heißt. Und Emilie Wagner gab uns noch einige weitere Hinweise auf die vielfältigen Verbindungen von Schiller zu Ludwigsburg.
Von hier waren es jetzt nur ein paar Schritte bis zum Arsenalplatz. Emilie Wagner schilderte uns hier noch einmal sehr plastisch, dass ja in Ludwigsburg zum damaligen Zeitpunkt einfach nichts los war. Ludwigsburg war kein Knotenpunkt, dazu die vorhin geschilderten Schwierigkeiten mit dem Bahnhof und der dadurch fehlende Anreiz für die Industrie. Die Bevölkerungszahl ging steil nach unten. Deshalb beschloss Carl Eugen hier eine Garnison zu errichten. Der rechteckige Straßenbau war perfekt, so dass hier die Soldaten wunderbar marschieren konnten. Und es war Platz für eine Kaserne nach der anderen. So stand dann jenseits der Stuttgarter Straße im Osten bald ein Militärgebäude neben dem anderen, insgesamt 22 Gebäude. Emilie Wagner konnte gar nicht alle aufzählen. Und schon bald war Ludwigsburg die zweitgrößte Garnison im Kaiserreich, wie sie uns nicht ohne Stolz erzählte.
Doch dann erboste sie sich über die Tatsache, dass Ludwigsburg unter Carl Eugen eine Stadtmauer bekam, die nur durch die verschiedenen Torhäuser betreten bzw. verlassen werden konnte. „Ludwigsburg wurde eingezäunt wie ein Zoo!“ entrüstete sie sich und auch darüber, dass sich die Soldaten oft unglaublich schlecht benehmen würden. „Kein Wunder, dass man uns Lumpenburg nennt“, war ihr Kommentar.
Danach ging unser Spaziergang weiter über die Seestraße zur Oberen Marktstraße. Als wir dabei am Rathaus vorbeikamen, erfuhren wir noch, dass Eberhard Ludwig seinerzeit befand, dass es kein Rathaus brauche, wenn’s den Herzog im Ort hat. Erst bei Carl Eugen fand dann das Ansinnen des Magistrats Gehör und es wurde der Bau des Rathauses beschlossen.
Schon standen wir in der Oberen Marktstraße. Wir erfuhren, dass Albert Lotter 1865 das Haus Obere Marktstraße 4 erwarb, wo bis dahin der über die Grenzen hinaus bekannte Gasthof „Zur goldenen Kanne“ war. Vielen von uns war neu, dass dieses Unternehmen sich ursprünglich aus einer Konditorei und Specereiwarengeschäft entwickelt hat. In das Sortiment dieses Gemischtwarenhandels wurden dann auch Eisenwaren aufgenommen, für die eine immer größere Nachfrage bestand. Nach dem Umzug in die Obere Marktstraße wurden hier nun Eisen- und Haushaltswaren verkauft. Der Sohn Paul übernahm später nach dem Tod seiner Eltern den Betrieb und wurde zum „königlichen Hoflieferant“ ernannt, was ihm eine entsprechende gesellschaftliche Anerkennung einbrachte.
Es ging die paar Schritte noch weiter zum Marktplatz. Auch hier gab die Fabrikantengattin Emilie Wagner in ihrer humorvollen Art wieder einiges zum Besten. “Den hat der Frisoni doch gut hingekriegt. So richtig italienisches Flair“ schwärmte sie. Wir erfuhren noch, dass der in der Mitte stehende Brunnen mit dem Standbild des Stadtgründers Eberhard Ludwig von Ferretti gefertigt wurde. Dann lenkte sie unsere Blicke auf die den Marktplatz umgebenden Häuser und erzählte uns, dass Eberhard Ludwig ja unbedingt den Bau seiner Stadt voranbringen wollte und deshalb 1720 befahl, dass die Oberämter und Ämter des Landes hier je ein Amtshaus zu errichten hatten. In diesen Amtshäusern sollten dann Büroräume geschaffen und die Beamten dieser Ämter einziehen. Von den ursprünglich geplanten 12 Amtshäusern sind dann 10 Häuser entstanden, die alle nach dem gleichen Baumuster geschaffen wurden.
Dann lenkte Emilie Wagner unsere Blicke auf die beiden Kirchen am Marktplatz. Vielen von uns war bis dahin noch gar nicht aufgefallen, dass an der Evangelischen Stadtkirche oben auf den beiden Türmen anstelle eines Kreuzes, eines Lamms oder eines Hahnes die Initialen „EL“ für Eberhard Ludwig angebracht sind. Und an der Frontseite oberhalb des Landeswappens ebenfalls. Es folgte noch ein kurzer Hinweis auf den Türmer und dessen taube Tochter, die oben im Turm eine kleine Wohnung hatten und die Stadt warnen mussten, wenn irgendwo ein Feuer ausbrach.
Die gegenüber stehende, heute katholische, Kirche wurde in den 1720er Jahren erbaut und diente vor dem Verkauf an die katholische Kirchengemeinde zeitweise als evangelische Garnisonskirche, bevor 1903 die heutige Friedenskirche an der Stuttgarter Straße als neue Garnisonskirche eingeweiht wurde. Und wir erfahren noch, dass die damals geflüchteten Andersgläubigen, Waldenser und Hugenotten im 1. Stock der Gaststätte Waldhorn ihren Gebetssaal hatten.
Mit so vielen Informationen versehen ging es dann flotten Schrittes weiter Richtung Gartenstraße. Bei einem Zwischenstopp Ecke Wilhelm-/Hospitalstraße erhielten wir dann sehr viele Informationen über den damaligen Arzt Dr. August Hermann Werner und dessen segensreiches Wirken in Ludwigsburg. Vielen unter uns war bis dahin gar nicht bekannt, dass es in Ludwigsburg damals um 1836 ein Privatkrankenhaus gab, welches überwiegend durch große Spenden- und Opferbereitschaft von vielen privaten Gönnern finanziert wurde. Zwar gab es in Ludwigsburg bereits ein Stadt- und Bürgerspital, doch war dieses nur für Menschen gedacht, die auch das Bürgerrecht der Stadt besaßen. Alle anderen fanden darin keine Aufnahme. Dr. August Hermann Werner war eine Zeitlang Arzt in diesem Krankenhaus, bevor er 1841 eine Heilanstalt für verkrüppelte Kinder eröffnete.
Die württ. Königin Pauline unterstütze das Wirken von Werner und so vergrößerte sich die Kinderheilanstalt immer weiter und machte mit hochqualifizierter Behandlung von sich reden. Auch Margarethe Steiff (Gründerin der Firma Steiff-Tiere) wurde hier in den Wernerschen Anstalten behandelt. Wir erfahren weiter, dass August Hermann Werner dann auch noch eine Anstalt zur Ausbildung von Diakonen und Krankenpflegern gründete. Auch die Orthopädische Klinik Markgröningen und die diakonische Einrichtung Karlshöhe sind aus den früheren Wernerschen Anstalten hervorgegangen.
Jetzt waren es nur noch ein paar Schritte bis zur Ecke Asperger-/Gartenstraße, wo uns unsere Führerin noch auf das sich dort befindliche Logenhaus der Ludwigsburger Freimaurer und die über dem Fenster angebrachte Jahreszahl 1887 hinwies. Und wir erfahren noch, dass ein Stück weiter unten einst das Gasthaus „Englischer Garten“ mit einem Badehaus stand.
Damit endete unser Stadtspaziergang mit der Fabrikantengattin Emilie Wagner. Wir bedankten uns für die vielen interessanten Informationen, die sie uns so humorvoll und kurzweilig dargebracht hatte und verabschiedeten uns herzlich von ihr. Auch beim späteren gemeinsamen Mittagessen, an dem noch die meisten von uns teilnahmen, waren wir uns alle einig, dass dies wieder eine ganz tolle Veranstaltung unseres ASP war und unserer lieben Kollegin, Anne Tschürtz, daher für die Vorbereitung und Organisation ein ganz großes Dankeschön gebührt. Und schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Veranstaltung am 7.Oktober. Denn wie wir schon so oft gesagt haben: „Mit‘m ASP isch’s oifach schee!“
Bericht: Horst Neidhart
Bildgestaltung und Homepage: Rolf Omasreither

Tagestour zur Deutschordensstadt Gundelsheim
Haben auch Sie das Himmelsreich schon mal gesehen?
Wir durften uns bei dieser Tour am Anblick dieser sehr schönen Weinlage oberhalb des Neckars in Gundelsheim erfreuen, um dann von unserem Stadtführer zu erfahren, dass der Aufstieg dorthin „soviel Treppen hat wie das Jahr Tage“. Doch wie heißt es von den Betreibern des ansässigen Weinbau Pavillons so treffend: „Nur steil ist geil“! Und es handelt sich in der Tat um die steilste noch bewirtschaftete Weinlage in Württemberg. Aber wir wollten ja nicht bewirtschaften, stattdessen bestand für uns ja die Möglichkeit, das Endergebnis beim vorher eingenommenen Mittagessen im Wein Pavillon zu genießen. Und so wissen wir nun, dass es durchaus beschwerlich sein kann, ins Himmelsreich zu kommen.
Doch beginnen wir von vorn: Obwohl die Abfahrt am Bahnhof Ludwigsburg ja erst auf 09:53 Uhr angesetzt war, fanden sich viele der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen schon sehr viel früher ein. So war es denn auch wieder ein „großes Hallo“ und eine freudige Begrüßung untereinander. Wobei die erfreulich hohe Teilnehmerzahl von 39 schon ganz gespannten und neugierigen Kolleginnen und Kollegen zeigte, wie groß das Interesse an dieser Tour war. Und so will ich den beiden Kollegen vom ASP-Team, Reinhard Fröhlich und Werner Knoll, schon jetzt ganz herzlich dafür danken, dass Sie so ein – wie sich später zeigte – interessantes Ziel für uns ausgesucht, und durch Einkehr im Weinbau-Pavillon, der späteren Stadtführung und der abschließenden Schifffahrt diesen Tag zu einem großen Erlebnis für uns alle gemacht haben. Dass dann auch noch der Wettergott uns wohlwollend gesinnt war, hat das Ganze zusätzlich noch getoppt.
Am Bahnhof von Gundelsheim angekommen, war es nur ein kurzer Fußweg in die Oststraße zum Weinbau Pavillon-Besen. Auf dem Weg dorthin passierten wir den sehr schön angelegten Vorgarten eines Hauses mit einem großen Fischteich. Etwas später konnten wir an einem Rundbogen das Stadtwappen von Gundelsheim entdecken. Dieses Wappen wurde der Stadt übrigens am 13. März 1538 vom Administrator des Hochmeistertums und Deutschmeister Walther von Cronberg verliehen. Bei genauem Hinsehen erkennt man eine Vierteilung. Das erste Feld mit dem Deutschordenskreuz weist auf die Zugehörigkeit der Stadt zum Deutschen Orden hin. Das zweite Feld mit den blauen Eisenhütchen ist dem Familienwappen des Stifters entnommen, während die sogenannte Kirchenspange des dritten Feldes das Wappen der Herren von Horneck (Schloss und Deutschordensresidenz) ist. Im vierten Feld unten rechts deutet der blaue Wellenbalken auf die Lage am Neckar hin und der Buchstabe „G“ auf den Stadtnamen.
Schon stehen wir vor dem Weinbau Pavillon mit dem angeschlossenen Besen. Einige unter uns staunen über die Ausgestaltung des Hofes und später auch noch über die rustikale Innendekoration. Schnell haben wir uns auf die uns zugewiesenen Plätze in der schön gestalteten Scheune verteilt. Die Art und Weise, wie unsere Bestellungen dann aufgenommen wurden, zeigte von einer gut durchdachten Organisation. Die Zeit bis zum Servieren der bestellten Gerichte nutzten die Kollegen Helmut Rath und Werner Knoll um uns noch einmal herzlich willkommen zu heißen. Helmut Rath wies darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder 200 Kolleginnen und Kollegen an den ASP-Veranstaltungen teilgenommen haben, worüber sich sowohl er, wie auch das gesamte ASP-Team sehr freuen würden. Und auch Werner Knoll betonte, wieviel Freude es den Organisatoren immer machen würde, wenn sie eine hohe Resonanz für ihre geplanten Veranstaltungen erfahren dürfen. Dann wurde es deutlich stiller im Raum, die bestellten Essensgerichte wurden serviert. Und um es kurz zu machen: es schmeckte uns allen prima und wir staunten über die Größe der Portionen. So waren wir anschließend für die bevorstehende Stadtführung gut gerüstet.
Unsere beiden Stadtführer, die Herren Leo Achtziger und Werner Heinz, trafen pünktlich ein und baten darum, uns in zwei Gruppen aufzuteilen, was auch ruck-zuck erfolgte. Wie uns versichert wurde, seien beide Führungen identisch, lediglich die Reihenfolge der Wegführung etwas verändert. Ich selbst war bei der Gruppe mit Herrn Heinz und kann daher nur aus dieser Perspektive heraus berichten.
Also los geht’s! Erste Frage unseres Führers: „Hend’r au guad gessa?“ Was wir natürlich mit „Ja!“ beantworteten. Darauf die nächste Frage: „Send‘r au älle einigermaßa guad zu Fuß?“ Nachdem wir auch dies spontan bejahten, zogen wir gleich flotten Schrittes los. Bald standen wir unterhalb der Katholischen Stadtpfarrkirche St. Nikolaus und erfuhren, dass hier 1805 alles katholisch war. Dann zeigte uns Herr Heinz erst einmal das Wappen des Deutschordens, welchem wir im Lauf der Führung noch mehrmals begegnen würden.
Das Kennzeichen des Deutschen Ordens war das schwarze Kreuz auf silbernem (weißen) Grund. Im Prinzip ist es ein einfaches, durchgehendes Kreuz. Die Form des Ordenszeichens wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte vom einfachen Balkenkreuz zum schwarzen Tatzen Kreuz auf weißem Grund. Das Eiserne Kreuz und auch das Symbol der heutigen Bundeswehr gehen übrigens auf dieses Deutschordenskreuz zurück.
„Warum beginne ich hier?“ fragte uns der Führer, um die Antwort gleich selbst zu geben: „Weil hier die Stadt Gundelsheim beginnt. Gundelsheim wurde ja erst später zur Stadt. Früher war es ein Dorf, und das war etwa 1 km weiter südlich.“ Und er fuhr fort: „Wo wir jetzt stehen, war noch gar nichts. Zunächst war nämlich nur das Schloss Horneck.“ Dieses Schloss wurde im 12. Jahrhundert gebaut. Konrad von Hornegg stiftete das Schloss dann 1255 dem Deutschen Orden. Nun folgten einige Informationen zum Deutschen Orden. So erfuhren wir, dass der Deutsch Orden, wie auch die Johanniter-, Malteser-, und Templer-Orden alle während der Kreuzzüge entstanden sind.
Demnach liegen die Ursprünge des Deutschen Ordens in einem Feldhospital vor Akkon, welches 1190 von Kaufleuten aus Bremen und Lübeck eingerichtet wurde, um erkrankte Pilger und verwundete Kreuzfahrer zu betreuen. Akkon ist eine alte Hafenstadt an der Küste des östlichen Mittelmeers in Israel. Papst Innozenz III. bestätigte 1199 die Umwandlung dieser Spitalbruderschaft in einen Ritterorden zum Schutz der Pilger im Heiligen Land.
Neben militärischen Aufgaben blieben zunächst Krankenpflege und Armenfürsorge wichtige Schwerpunkte der Ordenstätigkeit. Diese Verbindung des ritterlichen Elements der Kreuzfahrer mit den Elementen christlicher Nächstenliebe hat damals viele Herrscher sowie Mitglieder des Feudal-Adels angesprochen und zu einer Vielzahl von Stiftungen und Schenkungen geführt, welche das Besitztum des Ordens beträchtlich ausweiteten. Damit entstanden im Lauf des 13. Jahrhunderts 13 Balleien (sog. Ordensprovinzen): Thüringen, Sachsen, Lothringen, Marburg, Westfalen, Utrecht, Biesen und Franken, sowie Koblenz, Böhmen, Österreich, Bozen und Elsaß-Burgund.
Wie wir weiter erfuhren, hatte dann Papst Innozenz III. angeordnet, dass der Deutsche Orden in den Ostseeraum müsse, um dort die „heidnischen Pruzzen“, also Preußen, zu christianisieren. Dies führte auch wieder zu einer Reihe von Niederlassungen. Hier wurde uns dann insbesondere die Marienburg genannt, die an der Nogat, einem Mündungsarm der Weichsel, errichtet wurde. Laut Aussage die größte Burg der Welt und zudem der größte Backsteinbau Europas, inzwischen auch UNESCO-Weltkulturerbe. Diese Burg war von 1309 bis 1454 Sitz der Hochmeister des Ordens im Deutschordensstaat.
„Doch was passiert, wenn Einer groß und mächtig wird?“ lautete dann die Frage an uns. Und die Antwort kam auch gleich: „Dann werden die drumherum neidisch.“ Und so war es denn damals auch. Polen und Litauen haben sich zusammengeschlossen und gegen den Deutschen Orden Krieg geführt. So kam es 1410 zur Schlacht bei Tannenberg mit einer schweren militärischen Niederlage des Deutschen Ordens und der Folge, dass sich der Orden von dort zurückziehen musste.
Jetzt wohin, sei die große Frage gewesen. Denn der Orden hatte ja eine riesen Verwaltung. So gab es Streubesitz oben vom Ostseeraum bis runter zum Stiefel von Italien oder an die Südseite von Spanien. Wie uns erklärt wurde, hatte der Besitz zusammengenommen etwa die Größe von ganz Württemberg. Das Alles war eingeteilt in die bereits oben erwähnten 13 Balleien sowie 150 Komtureien (Niederlassungen der Rittersorden, auch Kommende genannt). Das musste alles verwaltet werden. Hier kam dann die Ballei Franken ins Spiel, denn diese war die größte Ballei. So beschloss man, die gesamte Verwaltung zu zentralisieren und hat hierfür das Schloss Horneck ausersehen, welches ja schon gestanden hat. Dieser Vorgang hat laut dem Stadtführer 10 Jahre gedauert. Von 1420 bis 1525 war hier die zentrale Verwaltung des gesamten Deutschen Ordens.
Dann habe der Deutsche Orden gesagt, wenn wir wo einziehen, dann muss um uns herum eine Stadt sein. So hat der Deutsche Orden dann innerhalb von 60 Jahren diese Stadt gebaut, die ja quasi im Umriss und mit vielen Häusern von damals noch besteht.
Nach diesen umfangreichen, interessanten Ausführungen zum Deutschen Orden gab es einen Themawechsel und unser Blick wurde auf die Mauern von den Stadtgräben gelenkt. Hier, so erfuhren wir, hatte man in den Gräben früher Hunde freilaufen lassen, und ihnen außer Abfällen nichts zum Fressen gegeben. Damit war ein gefahrloses Durchqueren für Menschen quasi unmöglich.
Danach blickten wir erneut auf die Kirche, wo wir ja standen. „Heilen und Helfen“ sei das Motto des Deutschordens gewesen. Darum habe der Orden hier eine Kirche gebaut. Allerdings nicht diese, wo wir jetzt standen, sondern die mit dem Chor nach Osten ausgerichtete Anna-Kapelle. Und da, wo jetzt das Kirchenschiff steht, da war damals das Hospital. Kirche und Hospital wurden überall als erstes gebaut. Das zweigeschossige Spital wurde mit einem überdachten Gang westlich an die Kirche angebaut. Doch im Bauernkrieg 1525 wurden Kirche und Spitalgebäude stark beschädigt, danach jedoch wieder instandgesetzt. Um 1700 wurde die Kirche barockisiert. Nördlich des Chors an dem kleinen Anbau mit Außentür ist noch die Jahreszahl 1701 zu sehen. In den Jahren 1922/23 wurde das Kirchenschiff um etwa das Doppelte verlängert und zusätzlich um ein Seitenschiff nach Norden erweitert. Die Frühmesskapelle und das nördliche Seitenschiff sind durch großzügige gotische Bögen offen mit dem Hauptschiff verbunden. Dann wies uns Herr Heinz noch auf ein historisches Epitaph hin, welches hier in die Außenwand eingelassen ist. Es zeigt den Ritter Fuchs von Kannenberg.
„So, jetzt steigen wir ein in die sogenannte Gässles-Führung“ hieß es dann, und wir gehen wieder los in Richtung Altstadt. Vorher weist uns der Stadtführer noch auf die Straßengestaltung in der Altstadt hin. Die Hauptverbindung bildet ein Kreuz, und die umliegenden kleineren Gassen gehen wie bei einem Kamm von der Seite aus hinein. Ein Teilnehmer unserer Gruppe ist noch etwas irritiert ob des auf der Kirchturmspitze angebrachten „Gockels“, weil dies ja normalerweise stets auf eine evangelische Kirche hindeuten würde. „Des isch halt a katholischer Gockel!“ war die knappe Erklärung, die natürlich bei uns allen ein Schmunzeln auslöste.
Bald kommen wir an einem prächtigen Renaissance-Bürgerhaus vorbei. Das Gebäude wurde um 1550 errichtet und 1595 vom Deutschen Orden als Ersatz für das ursprünglich westlich direkt an die Spitalkirche anschließende Spital erworben. Auch dieses Gebäude wurde 1525 im Bauernkrieg zerstört, aber danach wieder aufgebaut. Später erwies es sich als zu klein und beherbergt seit 1832 eine Apotheke. Ins Auge fällt uns der markante Renaissance-Erker und die sich daneben befindliche Barockstatue. Diese zeigt die heilige Elisabeth von Thüringen mit einem Bettler und stammt von 1777. Diese Heilige war Patronin des Deutschen Ordens und eine Wohltäterin der Armen.
Etwas später werden wir auf ein altes Haus mit fränkischem Fachwerk hingewiesen, und hier vor allem auf die an der linken oberen Hausecke angebrachte „Abweis-Fratze“ mit Maulschelle. Solche Fratzen sollten böse Geister und alles Unheil abwenden.
Vermutlich war jedoch kein böser Geist, sondern nur der „seligmachende Geist des Weines“ schuld daran, dass unser ehemaliger Bundespräsident, Theodor Heuss, hier in Gundelsheim bei seinem Abi-Ausflug ins Straucheln kam und sich schwere Verletzungen zuzog, die ihn jedoch dadurch untauglich für den Wehrdienst im 1. Weltkrieg machte. So gesehen doch noch Glück im Unglück.
Nach dieser kurzen Episode, die bei uns natürlich wieder ein Schmunzeln auslöste, ging es eine ziemlich schmale Treppe empor und wir standen an einem Eckturm der Stadtbefestigung mit einem schönen Ausblick auf den unten fließenden Neckar mit der Gundelsheimer Schleuse und der gegenüberliegenden Burg Guttenberg, einer der letzten unzerstörten Staufer-Burgen in Deutschland. Dabei erfuhren wir noch, dass es in der Schlossstraße, die wir gerade hochgegangen sind, damals innerhalb kurzer Zeit 10 Schneidereien, 3 Änderungsschneidereien und 3 Hutmacher gab.
Oben angekommen, können wir noch einmal einen Blick auf die Weinlage „Himmelsreich“ werfen und erfahren, dass rund 40 Hektar Anbaufläche vom Staatsweingut Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg bewirtschaftet werden. Dadurch sind hier auch immer Studenten aus aller Herren Länder anzutreffen, die sich für kultivierten Weinbau interessieren.
Jetzt gab es noch Informationen zum Schloss selbst. Dieses wurde 1533 vom Deutschen Orden auf den im Bauernkrieg zerstörten Ruinen der alten Burg errichtet. Dabei wurde der weitgehend erhaltene, 35 Meter hohe, Bergfried der Turm der neuen siebeneckigen, renaissancezeitlichen Schlossanlage. 1724 wurde dann der Bau jedoch barockisiert und die Renaissance-Erker und -Türme wieder abgerissen. 1807 wurde Schloss Horneck in eine Militärkaserne umgewandelt und im Herbst 1814 ein Militärspital eröffnet. Über dem ehemaligen Marstall wurde dann sogar eine Bierbrauerei, die Schlossbrauerei Hornegg, eingerichtet. Also eine doch sehr wechselhafte Geschichte. Aber offenbar hatte die Brauerei nicht den erwarteten Gewinn erbracht und so wurde das Schloss Horneck erneut zum Verkauf angeboten und wie in der Siebenbürgischen Zeitung nachzulesen ist, in einer Anzeige als „in gesündester und wärmster Lage Württembergs gelegen und mit prachtvoller Fernsicht begünstigt“ angepriesen. 1890 wurde im Schloss dann eine „Wasserheil-, Bade- und Kur-Anstalt“ eingerichtet. Zum Leiter der Kuranstalt wurde der Mediziner Dr. Ludwig Roemheld berufen, der später zum Ehrenbürger von Gundelsheim ernannt wurde. Und wie uns Herr Heinz dann nicht ohne Stolz erzählte, hätten viele illustre Kurgäste dieses Sanatorium und Nobelbad besucht, welches neben rund 50 km Wanderwegen in die Umgebung auch zwei Kurparks mit Orangerie und einen Tennisspielplatz zu bieten hatte. So nannte er uns als Kurgäste die Königin Charlotte von Württemberg, die Schauspieler Heinrich George, Gustav Gründgens oder Marianne Hoppe, aber auch den Bergsteiger Luis Trenker oder Boxweltmeister Max Schmeling. Zu diesem Zeitpunkt war das mondäne Sanatorium weit über die Region hinaus bekannt und beliebt, was auch in den folgenden Zeilen eines unbekannten Autors zum Ausdruck gebracht wurde:
„Wer den Rhythmus seines Lebens bei den Sternen hat gesucht,
wer im Lebenskampf vergebens seinen Nerven hat geflucht,
wem die Kost nicht mehr will schmecken, Schlummer nicht die Augen kühlt,
Trank und Speise bleiben stecken, Unrast Leib und Hirn zerwühlt:
Der verlaß‘ sein Heimgestade, sei er Bürger oder Ferscht,
und such‘ Heilung, suche Gnade, wo Geheimrat Römheld herrscht!“
Im ersten Weltkrieg wurde das Schloss in ein Kriegslazarett umgewandelt. Nach Kriegsende wurde der Kurbetrieb dann wieder aufgenommen. Doch der zweite Weltkrieg bedeutete das Ende der Kuranstalt und das Schloss wurde erneut ein Kriegslazarett. 1947 gab es wieder eine Änderung: die Heilstätte für Tuberkulosekranke wurde von der Heilanstalt Weinsberg auf Schloss Horneck verlegt. Im Volksmund wurde das Schloss daher auch als „Hustenburg“ bezeichnet. Als Kinder sei ihnen von ihren Eltern streng verboten worden, das Schlossgelände zu betreten oder Sachen anzufassen. Die Lungenheilstätte wurde 1960 in die neu erbaute und größere Lungenfachklinik Löwenstein verlegt. Danach war zunächst „Sendepause mit großem Gejammer“ wie es Herr Heinz ausdrückte. Wie wir erfuhren, ist das Schloss nun im Besitz der Siebenbürger Sachsen und wurde 2020 kernsaniert und zu einem Kultur- und Begegnungszentrum mit Hotel Garni, Bibliothek und Museum umgebaut. Das Hotel würde sehr gerne für Hochzeiten gebucht. Zweimal im Jahr finden große Treffen der Siebenbürger Sachsen aus der ganzen Welt hier statt. Daneben gibt es noch ein Pflegestift, während das Altersheim jedoch inzwischen aufgelöst wurde.
Dann erfuhren wir noch, dass auf dieser abgelegenen Seite der Stadt damals auch sogenannte „Schutzjuden“ lebten. Schutzjuden hatten Anspruch auf Schutz des Eigentums und der körperlichen Unversehrtheit sowie auf Freizügigkeit und Religionsfreiheit. Dafür mussten sie jedoch an den Deutschorden Zahlungen leisten. Wie wir weiter erfuhren, haben sich diese Bürger ihre Häuser an die Schlossmauer gebaut, also quasi „symbolisch angelehnt“. Das erfolgte damals in der „Lehmgasse“, der heutigen Kaplaneigasse. Und wie wir noch erfuhren, wurde in diesem Bereich jetzt sogar ein „Reinigungsbad“, ein „Mikwe“ entdeckt. An der Freilegung wird derzeit noch weiter gearbeitet.
Unser Weg führte nun durch den früheren Marstall. Auch dies wieder ein Hinweis auf den damaligen Reichtum des Ordens. Damit befanden wir uns in dem äußeren Schlossgraben und konnten sehen, wie die Mauern immer größer und gewaltiger wurden. Unser Führer zeigte uns dann noch die „Villa Monrepos“ in der Roemheldstraße, die aussieht wie ein Schwarzwaldhaus. Und er berichtet uns, dass hier auch schon die Württembergische Königin logierte. Graf Zeppelin sei da auch schon mal mit seinem Luftschiff darüber gefahren (geflogen) und habe sich quasi genau darüber „verbeugt“. Natürlich sei dies nicht ganz ohne Grund geschehen. War doch das württ. Königshaus Hauptaktionär vom Friedrichshafener Zeppelin-Werk. Seit 2013 befindet sich ein Medizinisches Versorgungszentrum in der Villa.
Wir kamen dann an einem Haus vorbei, welches früher das Kameralamt beherbergte. Und mit Staunen erfuhren wir, dass in diesem Haus damals 50(!) Schreiber an Stehpulten tätig waren. Bei einem anderen älteren Gebäude erzählte uns der Führer, dass hier einmal die Königliche Hutmacherin gewohnt habe.
Inzwischen waren wir wieder an der Ostseite der Stadtgrabenmauer angelangt. Dahinter liege das Freibad, erfahren wir. Nun ging es an einer Mariengrotte in der Mauer vorbei und danach am alten Schulhaus in der Schulgasse. Das Gebäude wurde von 1785-1910 als Schulgebäude genutzt.
Plötzlich stieg uns ein intensiver Geruch in die Nase und wir erfuhren von dem gerade anwesenden Hauseigentümer, dass dieser zurzeit mosten würde. Doch wie sagte schon Johann Wolfgang Goethe: „Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, es gibt zuletzt doch noch e' Wein“. Der intensive Geruch begleitete uns noch eine Weile. Allerdings konnten wir nicht ins Schwanken geraten, denn dazu war der folgende Durchgang zwischen den Häusern einfach zu eng. So ging es weiter, bis wir erneut in der Stadt und an der Katholischen Stadtpfarrkirche St. Nikolaus angelangt waren. Und diesmal betraten wir die Kirche und betrachteten deren prachtvolle Ausgestaltung.
In der Kirche fallen einem sofort mehrere barocke Altäre ins Auge. Der Hauptaltar im Chor zeigt Nikolaus von Myra, der als Symbol drei goldene Äpfel trägt. Er wird flankiert von Papst Urban I, mit Trauben, und Bischof Blasius von Sebaste mit einer Kerze. An den beiden Nebenaltären sind Maria und Josef dargestellt. Interessant auch, dass Haupt- und Nebenaltäre aus Holz gefertigt sind und dann marmoriert angemalt wurden.
In der sich rechts befindlichen Frühmess-Kapelle befindet sich ein Altar, der aus den Überresten mehrerer historischer Altäre zusammengesetzt wurde. Der Mittelschrein zeigt eine Reliefdarstellung der Anna selbdritt: Maria und Anna auf Thronsesseln mit dem Jesuskind, dahinter musizierende Engel. Zu beiden Seiten des Mittelschreins befinden sich hölzerne Standfiguren der Hl. Katharina und Barbara, jeweils mit ihren Attributen in Händen und mit einer Krone auf dem Haupt. Der Sockel zeigt eine detailreiche Reliefschnitzarbeit mit der Wurzel Jesse. Die Arbeiten sind vermutlich um 1500 entstanden.
Nach der Besichtigung der Kirche, verbunden mit einigen Momenten des stillen Innehaltens, waren es dann noch etwa 10 Minuten Fußweg bis zur Anlegestelle des „Neckar Käpt’n“, wo bereits das Ausflugsschiff „Neckar-Fee“ auf uns wartete.
Auf dem Schiff hatten wir freie Platzwahl und konnten auch Speisen und Getränke bestellen. Noch immer hatten wir die Bilder und die dazu gelieferten Informationen im Kopf und unterhielten uns lebhaft darüber. Doch dann dauerte es nicht lange, und „unsere Fee“ tuckerte langsam los. Zunächst einmal ging es durch die Gundelsheimer Schleuse. Dies benötigte etwas Zeit und gab uns damit die Gelegenheit, weiter in der Unterhaltung fortzufahren. Aber als dann links und rechts die Uferpassagen an uns vorbeizogen, gab es für uns erneut viel zu sehen. Egal ob es die Bergkirche von Heinsheim war, oder die Kaiserpfalz von Bad Wimpfen, die Silhouetten von Jagstfeld, Bad Friedrichshall oder Kochendorf, wo wir erneut eine Schleuse passierten, was wieder Zeit gab für weitere Gespräche. Es folgten noch Neckarsulm, Neckargartach und letztlich unser Zielhafen Heilbronn. Auch diese Schifffahrt war ein besonderes Erlebnis, insbesondere da inzwischen auch die Abendsonne ihr warmes Licht auf die Uferpassagen strahlte und somit die schon vorhandenen Herbsttöne noch etwas intensiver leuchten ließ. Und schmunzeln mussten wir über manche Wasservögel, die sich fluchtartig vor dem immer näherkommenden Schiff in Sicherheit brachten und dabei zum Starten ja erst einmal schnell auf dem Wasser laufen mussten.
In Heilbronn hieß es dann aussteigen, was mancher von uns direkt etwas bedauerte. Nun folgte ein flotter Fußmarsch zum Hauptbahnhof, wo wir gerade noch den Zug nach Ludwigsburg um 18:30 Uhr erwischten. Erneut hieß es wieder Maske aufsetzen. Hin und wieder der einen Kollegin oder dem anderen Kollegen noch schnell zum Abschied zuzuwinken, wenn diese den Zug schon vor Ludwigsburg verließen, um einen entsprechenden Anschluss für die Weiterfahrt zu ihrem Heimatort zu nutzen.
Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an einen erlebnisreichen Tag, der uns allen sehr gut gefallen hat. Deshalb gilt hier noch einmal unser aller herzlicher Dank an Rainer Fröhlich und Werner Knoll, die nicht nur so eine schöne und erlebnisreiche Tour gut vorbereitet, sondern auch für die gute Durchführung gesorgt hatten. Danke Euch beiden und dem gesamten ASP-Team für die damit verbundene Arbeit und sicher auch manchmal gehörige Mühe. Jetzt warten wir alle schon ganz gespannt, welche weiteren Veranstaltungen im kommenden Jahr geplant sind. Denn wir alle können nur immer wieder aus vollem Herzen betonen:
„Mit’m ASP isch’s halt immer schee!“
Bericht: Horst Neidhart
Bildgestaltung: Rolf Omasreither